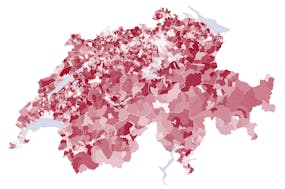Volksweisheiten sind das Ergebnis jahrhundertelanger Erfahrung. «Wer die Wahl hat, hat die Qual» ist eine solche Volksweisheit. Widerspricht das der liberalen Überzeugung, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Politik und Gesellschaft wettbewerblich organisiert werden sollten? Dass es also eine Vielzahl von Anbietern geben sollte? – Die Antwort lautet: nein.
Und zwar nicht nur, weil der Wettbewerb zu Effizienz und höherer Produktivität führt und uns reicher macht. Und auch nicht nur, weil er ein grossartiges Entdeckungsverfahren ist, wie die Ökonomen Friedrich August von Hayek und Joseph Schumpeter gezeigt haben. Sondern eben auch, weil nur der Wettbewerb des Angebots der Vielfalt der Nachfrage gerecht werden kann.
Denn klar ist, Wettbewerb zwingt zwar die Konsumenten und Investoren, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber auch die Wähler und Stimmbürger zu oft schwierigen Entscheiden. Aber er ermöglicht zugleich überhaupt erst die Wahl zwischen Alternativen. Wo kein Wettbewerb herrscht, kann es keine Wahlfreiheit geben. Ältere Leserinnen und Leser mögen sich noch an das kommunistische China unter Mao erinnern, als man am Fernsehen Bilder sah, in denen das ganze Volk praktisch gleich gekleidet war. Das mag in Situationen grössten Elends oder während Kriegen eine Möglichkeit sein, allen das Nötigste zum Überleben zu sichern, aber erstrebenswert ist das wohl für die wenigsten (obwohl es durchaus Romantiker gab, die das damals anders sahen).
Nur Wettbewerb und Wahlfreiheit zusammen garantieren ein Angebot, das den Bedürfnissen der Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit gerecht wird. Die Strassenbilder belegen das: Kleidung, Autos, Architektur, Geschäfte, Restaurants. Mancher beklagt zwar, dass als Folge der Globalisierung gewisse konsumnahe Unternehmen und Marken auf der ganzen Welt anzutreffen sind und damit die lokale Identität der Städte zerstören. Aber in den einzelnen Städten besteht gerade wegen der Globalisierung eine unglaubliche Breite des Angebots. Bereicherte früher einzig der Italiener um die Ecke das kulinarische Angebot, gehören heute der Inder, der Japaner, der Thailänder, die Tapas-Bar, der Hamburger-Grill oder der Tacos- Stand wie selbstverständlich auch zum Angebot, das je nach Lust und Laune genutzt wird.
Doch so sehr man diese Wahlmöglichkeiten schätzt, stimmt das von der Qual der Wahl eben gleichwohl. Sich entscheiden fällt den meisten Menschen schwer. Nur schon sich bewusst werden, was man wirklich will, ist oft nicht einfach. Vor allem aber bedeutet ja ein Entscheid für ein bestimmtes Produkt immer zugleich, auf etwas anderes zu verzichten. Wenn man den Wellness- Urlaub im Berner Oberland verbringt, kann man ihn nicht gleichzeitig im Engadin verbringen.
Deswegen kennen wir alle aus dem Alltagsleben die gelegentliche Erleichterung darüber, dass einem der Mangel an Wahlmöglichkeiten einen Entscheid abnimmt, dass eines von zwei interessanten Museen geschlossen ist und es daher weder grosse Diskussionen in der Gruppe noch ein inneres Ringen um den optimalen Entscheid gibt.
Doch die «Qual der Wahl», die Tatsache, dass wir selbst für so banale Entscheide wie die Wahl des passenden Kleides oder Anzugs auf den Rat der Freundin oder des Freunds angewiesen sind, bedeutet nicht, dass wir auf Wahlmöglichkeiten verzichten möchten, denn das Gegenteil ist erst recht richtig: Wer keine Wahl hat, hat die Qual.
Die «Qual der Wahl» drückt nur aus, dass die Befriedigung unserer Bedürfnisse in einer knappen Welt nie ohne Verzicht abgeht. Die Ökonomen nennen das Opportunitätskosten. Wenn wir etwa im Gesundheitswesen höhere Leistungen möchten und dafür höhere Prämien bezahlen müssen, werden wir dafür vielleicht bei etwas anderem Abstriche machen müssen.
Deshalb möchte wohl niemand grundsätzlich auf Wahlfreiheit bei Konsumgütern wie Kleidern, Essen und Getränken, Möbeln, Autos oder Feriendestinationen, um nur wenige zu nennen, verzichten. Umso erstaunlicher ist eine merkwürdige Tendenz in der Gesellschaft, gerade in besonders zentralen Belangen die Wahlmöglichkeiten einzuschränken. Das Argument lautet meist, die Entscheide seien zu schwergewichtig und zu schwierig. So herrscht etwa in der Altersvorsorge in der zweiten Säule fast keine Wahlfreiheit, obwohl diese durchaus mit dem Obligatorium, also der Versicherungspflicht, vereinbar wäre. Und im Schulwesen vergibt man sich mit der Wahl des Wohnortes die Möglichkeit, seine Kinder in eine Schule der eigenen Wahl zu schicken – sieht man von Privatschulen ab.
Es scheint, dass sehr viele Menschen gar nicht so unglücklich darüber sind, dass man ihnen diese noch viel schwierigeren Entscheide als jene zwischen zwei Automarken abnimmt. Die Folgen sind aber immer die gleichen: ungenügende Bedarfsgerechtigkeit und schwache Innovation. Beides nimmt man unweigerlich in Kauf, wenn man Einschränkungen der Wahlfreiheit akzeptiert.
Nur bei der Partnerwahl, die noch schwieriger, vor allem aber noch prägender ist als jene zwischen zwei Versicherungsangeboten, da möchten die meisten dann doch nicht auf die eigenen Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten verzichten. Das ist auch gut so. Aber man sollte sich vielleicht überlegen, ob Wahlfreiheit in anderen wichtigen Belangen wie der Altersvorsorge, dem Gesundheitswesen oder der Ausbildung auf Pflichtschulstufe nicht ebenso angebracht wäre und deshalb gestärkt werden sollte.
Dieser Artikel erschien im Kundenmagazin der «Sanitas» vom März 2013.