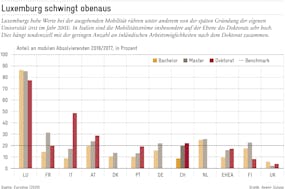Bildungspolitiker rund um den Globus interessieren sich neuerdings für eine Schweizer Spezialität: die Berufslehre. Und dies aus gutem Grund, denn die Kombination aus betrieblicher Praxis unter Aufsicht des Lehrmeisters und schulischem Lernen hat sich über Jahrzehnte als sehr erfolgreich erwiesen. Entscheidend ist ebenso der direkte Einbezug der Wirtschaft: er sorgt nämlich dafür, dass nicht ins Blaue hinaus ausgebildet wird. Im Wesentlichen werden diejenigen Berufsausbildungen angeboten und durchlaufen, für die es später auch Stellen gibt. Dies hat die Schweiz (bisher) vor einer «Überakademisierung» bewahrt, unter der viele Staaten heute leiden. Diese Länder bilden zwar viele qualifizierte Akademiker aus, aber was nützt dies, wenn die entsprechenden Jobs schlicht fehlen?
Prozesse anwenden UND verstehen
Doch auch in der Schweizer Berufsbildung zeigen sich Spannungen und Reibungsverluste. Viele Firmen klagen, dass geeigneter Nachwuchs für die Berufslehre zunehmend schwierig zu gewinnen sei. Über die Ursachen wird in Bildungskreisen debattiert und gestritten. Ein Grund besteht darin, dass die Anforderungen und Erwartungen an die angehenden Lernenden in den letzten Jahren gestiegen sind, besonders in den anspruchsvollen Industrieberufen wie dem Polymechaniker oder dem Automatiker, aber ebenso im Bank- oder Versicherungs-KV. Anders gesagt: die Entwicklung zur «wissensbasierten Ökonomie» hat auch die Berufsbildung erreicht. Dieser schillernde Begriff bedeutet konkret, dass Verfahren und Prozesse nicht nur angewendet, sondern auch vertieft verstanden werden müssen. Nur so kann die erforderliche Flexibilität sichergestellt werden. Das vorhandene Vorwissen aus der Sekundarschule ist dadurch oft knapp geworden, mit der Folge, dass die Lehrmeister vermehrt auf die Noten achten und Einstufungstests vorschreiben. Über kurz oder lang werden die Lehrfirmen, die zu wenig geeignete Kandidaten finden, ihr Lehrstellenangebot einschränken oder sich im Extremfall ganz aus der Berufsbildung verabschieden. Dies gilt es zu verhindern. Darum stellt sich die Frage, ob einzelne anspruchsvolle Berufe nicht neu definiert und inskünftig auch auf höherem Niveau und etwas später erlernt werden könnten. Allerdings wird die grosse Mehrzahl der Lehrberufe – namentlich die gewerblichen – ihren angestammten Platz im Bildungssystem behalten.
Vor diesem Hintergrund hat Avenir Suisse einen Pilotversuch für ein duales Studium angeregt. Diese Idee überträgt das Prinzip der klassischen Berufslehre auf die Bachelorstufe. Entsprechend tritt eine Fachhochschule an die Stelle der Berufsfachschule. Ein entscheidender Unterschied zu den heutigen Werkstudenten und berufsbegleitenden Studien besteht im Auswahlverfahren in ein solches Programm: «Selektionär» ist der ausbildende Betrieb. Zugangsvoraussetzung ist – neben einer gymnasialen oder beruflichen Maturität (BMS) – also ein Lehrvertrag mit einer Firma. Die Arbeit im Betrieb ist nicht einfach ein «Brotjob» zur Finanzierung des Studiums, sondern die praktische und theoretische Ausbildung ist inhaltlich und zeitlich abgestimmt. Für die Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, künftige Kader früher zu rekrutieren und zu binden. Damit liesse sich das Interesse an der praxisorientierten Ausbildung stärken, vor allem in Branchen und Unternehmen, die heute kaum in der Berufsbildung engagiert sind.
Das typische Eintrittsalter in ein duales Studium liegt zwischen 19 und 23 Jahren. Je nach Ausgestaltung würde ein solches Programm zwischen drei und fünf Jahren dauern, das Verhältnis von betrieblicher und schulischer Ausbildungszeit beträgt etwa eins zu eins. Im Unterschied zur klassischen Lehre findet der schulische Teil in der Regel nicht an gleichbleibenden Wochentagen statt, sondern längere schulische und betriebliche Sequenzen wechseln sich ab. Als Abschluss wäre ein Fachhochschul-Bachelor vorzusehen, möglicherweise mit dem Zusatz der Ausbildungsfirma. Ein duales Studium stellt wohl höhere Anforderungen an Zeitmanagement, Flexibilität und Sozialkompetenz der Absolventen als ein akademisches Studium. Dies sind aber genau die Eigenschaften, die auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt sind. Den Fachhochschulen bietet das duale Studium eine Chance, ihr Profil als praxisnahe Bildungsorte zu schärfen, anstatt einfach den Universitäten nachzueifern. Gleichzeitig würden die Universitäten entlastet, wenn Gymnasiasten, die mehr an einer berufsbezogenen Ausbildung interessiert sind, diese Alternative zur Verfügung hätten. Zu denken ist aber auch an den nicht unbedeutenden Teil von Studierenden, die an den universitären Selektionshürden hängen bleiben: Ihnen (besonders diejenigen der ETH) könnte ein anwendungsorientiertes duales Studium neue, und vielleicht sogar bessere Perspektiven eröffnen. Als Pilotbranchen eignen sich die Maschinenindustrie, der Finanzsektor, die Pharma- und Medtech-Branche, aber auch der Gesundheits- und Pflegesektor.
In Form der deutschen Berufsakademien existieren duale Studiengänge schon seit den 1970er-Jahren. Im Jahr 2011 wurden in Deutschland 930 duale Studiengänge und über 60 000 Studierende gezählt. Auch wenn der Markt teilweise noch in der Experimentierphase steckt, ist es wohl nicht vermessen, in diesem Modell eine Chance für die Berufsbildung zu erkennen.
Dieser Artikel erschien in der Beilage des Tages-Anzeigers «Aus- und Weiterbildung» vom 18. März 2013.