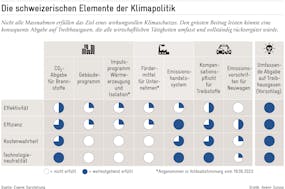Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Schweiz mit der EU ein Kooperationsabkommen im Bereich des Wettbewerbsrechts ausgehandelt. Die Verhandlungen sind unterdessen abgeschlossen, allerdings muss das Abkommen noch vom Parlament genehmigt werden. Das Abkommen würde es den schweizerischen und europäischen Wettbewerbsbehörden erlauben, künftig enger zusammenzuarbeiten und in Untersuchungen erlangte Informationen miteinander auszutauschen. Dies war bisher nur bei Vorliegen eines sogenannten «Waivers» (also einer expliziten Zustimmung der involvierten Unternehmen) möglich und vor allem bei internationalen Fusionsverfahren, in denen der Informationsaustausch im Interesse der beteiligten Unternehmen liegt, üblich. Das Abkommen regelt hingegen nicht die Zusammenarbeit mit den Wettbewerbsbehörden der einzelnen EU-Mitgliedstaaten, erlaubt keine Vornahmen von Ermittlungshandlungen durch die jeweils andere Wettbewerbsbehörde und beinhaltet auch keine Harmonisierung des materiellen Rechts.
Vermeidung von Doppelspurigkeiten
Ziel des Abkommens ist es, effizienter bei grenzüberschreitenden Verstössen gegen das Wettbewerbsrecht eingreifen zu können. Das ist sinnvoll und wünschenswert, denn mit fortschreitender Globalisierung werden auch Kartelle immer globaler – sie machen vor Staatsgrenzen keinen Halt. Davon zeugen die jüngst abgeschlossenen Verfahren gegen Speditions- und Luftfrachtunternehmen wegen weltweiter Preisabsprachen oder der zurzeit untersuchte LIBOR/TIBOR-Fall, in dem der Vorwurf im Raum steht, verschiedene Banken hätten koordiniert auf Interbanken-Referenzzinssätze Einfluss genommen. All diesen Fällen ist gemein, dass sie auch in der EU Untersuchungen auslösten. Eine engere Zusammenarbeit mit den europäischen Wettbewerbsbehörden hätte dazu beigetragen, Doppelspurigkeiten zu vermeiden und eine möglichst grosse Kohärenz der Entscheide zu garantieren.
Gesetze gelten nur im jeweiligen Hoheitsbereich
Trotz dieser Vorteile des Abkommens gibt es jedoch auch durchaus ernstzunehmende Kritik. Es wird befürchtet, dass durch die Möglichkeit eines Informationsaustauschs der Rechtsschutz für die Unternehmen ausgehöhlt wird und dass Abkommen dieser Art Begehrlichkeiten fremder Staaten in anderen Bereichen, etwa im Steuerrecht, wecken könnten. Obwohl solche Befürchtungen nicht gänzlich von der Hand zu weisen sind, illustrieren sie zugleich doch eine gewisse Schizophrenie der aktuellen Wettbewerbspolitik: Im Rahmen der anstehenden Revision des Kartellgesetzes diskutiert das Parlament nämlich allen Ernstes über die Einführung eines Lieferzwangs für Anbieter im Ausland zu dortigen Bedingungen. Abgesehen von der ökonomischen Unsinnigkeit einer solchen Bestimmung würde die Durchsetzung von Schweizer Recht im Ausland die hiesigen Wettbewerbsbehörden vor riesige Probleme stellen, denn Unternehmen ausserhalb der Staatsgrenzen sind zu keinerlei Kooperation in kartellrechtlichen Verfahren verpflichtet.
Soll eine solche neue Bestimmung im Kartellgesetz nicht einfach zum toten Buchstaben verkommen, müsste die Schweiz wohl im Minimum mit ihren Nachbarländern Kooperationsabkommen abschliessen, die inhaltlich weit über das eben ausgehandelte Abkommen mit der EU hinausgingen. Es müsste den schweizerischen Wettbewerbsbehörden erlaubt sein, im Ausland konkrete Ermittlungen vorzunehmen oder solche im Rahmen eines Amtshilfegesuchs einzufordern. Dass die Schweiz Gegenrecht gewähren müsste, versteht sich von selbst. Wenn aber bereits ein vergleichsweise harmloser Informationsaustausch mit der EU gewichtige Kritik und Skepsis auslöst, kann es nur als Zeitverschwendung und Alibiübung bezeichnet werden, dass sich das Parlament mit einem neuen, letztlich jedoch nicht durchsetzbaren Artikel im Kartellgesetz beschäftigt.