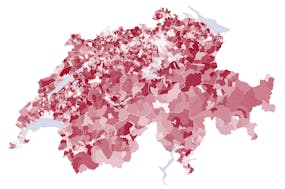Versteht man den Liberalismus als System von Prinzipien und Regeln wie individuelle Freiheit, Selbstverantwortung, «rule of law», Eigentumsrechte, Handels- und Gewerbefreiheit, solide Staatsfinanzen, Offenheit, Wettbewerb und Preisstabilität, kann nur ein starker Staat diese Freiheiten und Institutionen garantieren. So wenig man die Bibel dafür verantwortlich machen kann, dass Menschen gegen die zehn Gebote verstossen, kann man dem Liberalismus aber zur Last legen, dass seine Prinzipien und Regeln verletzt werden.
«Wohl des Ganzen»
Marc Chesney wählt in seiner Philippika gegen den Finanzsektor (NZZ 1. 7. 13), die in eine Abrechnung mit dem Liberalismus mündet, genau diesen Ansatz. Zu diesem Zweck zählt er ausgesprochen unanalytisch alle möglichen Missstände auf, ohne zu sagen, wie sie zusammenhängen und was sie mit der liberalen Ordnung eigentlich zu tun haben. Als Kronzeugen führt Chesney Ludwig von Mises an, der 1927 in seiner Schrift «Liberalismus» geschrieben hat, der Liberalismus habe immer das «Wohl des Ganzen, nie das irgendwelcher Sondergruppen im Auge». Mises wäre allerdings nie auf die Idee gekommen, die Gleichmässigkeit der Einkommensverteilung als Massstab dieses «Wohls des Ganzen» heranzuziehen, im Gegenteil: Er macht in der gleichen Schrift deutlich, dass es der grossen Masse heute besser geht als noch vor wenigen Menschenaltern den Reichen.
Die Gleichsetzung von Gemeinwohl und Gleichheit der Einkommensverteilung ist nicht nachvollziehbar, im Kontext von Mises sogar intellektuell unredlich. Chesney beschreibt nirgends, was er unter Liberalismus versteht und welches der Zusammenhang mit der neoliberalen Politik ist. Für den ideengeschichtlich etwas Vertrauten müsste etwa zwischen der österreichischen Schule (Mises, Hayek), der Chicago-Schule (Stigler, Friedman), dem deutschen Ordoliberalismus (Röpke, Eucken) und der Public-Choice-Theorie (Buchanan) unterschieden werden. Vor allem aber macht er nirgends klar, ob nun Deregulierung und Privatisierung ein Ausfluss des Liberalismus sind (als das werden sie üblicherweise dargestellt) oder nicht. Jedenfalls macht Chesney sie verantwortlich für «ein fragwürdiges System impliziter Regeln», die zu «too big to fail» und «moral hazard» geführt hätten, zur Kartellmacht der Rating-Agenturen, zur Subventionierung der Grossbanken durch eine implizite Staatsgarantie, zur Privatisierung von Gewinnen und zur Sozialisierung von Verlusten. Richtig ist, dass all das liberalen Prinzipien widerspricht, aber dann würde man gerne lesen, weswegen es zu diesen Verirrungen gekommen ist, etwa wegen falscher staatlicher Interventionen und Regulierungen, wegen zu viel Regulierungen oder umgekehrt wegen «zu viel» Liberalismus (was immer das heissen mag). Aus der Sicht von Chesney scheint die ohne Zweifel liberal inspirierte Politik der Deregulierung und Privatisierung so ziemlich für alles verantwortlich zu sein: dass es Lohnexzesse, Over-the-Counter-Geschäfte, Hochfrequenzhandel und derivative Produkte gibt, dass der Libor kein Marktzins ist und von den Banken manipuliert wurde, dass die Ärmsten der Welt nur zwei Dollar pro Tag zur Verfügung haben aber auch und vor allem, dass wir heute gegen viele liberale Grundsätze verstossen.
Man ist sich heute in der Wissenschaft einig darüber, dass die Finanzkrise ein vielschichtiges Phänomen ist, dem ein ganzes Bündel von Ursachen auf der Makro-, Mikro- und Regulierungsebene zugrunde liegt. Sie lässt sich als verhängnisvolles Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren erklären. Dazu gehören: die globalen Leistungsbilanzungleichgewichte, die zu expansive Geldpolitik des Fed, die implizite Staatsgarantie für grosse Finanzinstitute wegen der «Too big to fail»-Problematik, die Anreizmechanismen und Vergütungssysteme für das Management, die prozyklische Bankenregulierung (Eigenkapital und Liquidität) des Basler Ausschusses und die internationalen Rechnungslegungsstandards, das Unterlaufen von Eigenmittelvorschriften durch Ausgliederung von Krediten in Ausserbilanz-Vehikel, eine nicht zuletzt durch die Informatik möglich gewordene Fülle von Produktinnovationen, überforderte und z. T. unfähige Aufsichtsbehörden, die grenzüberschreitende Verflechtung des Interbankenmarkts, die Zielkonflikte der Rating-Agenturen und der staatlich geförderte «American dream» des billigen Eigenheims, der in die zu grosszügige Vergabe von Hypothekarkrediten mündete.
Niemand wird leugnen, dass im Finanzsektor vieles schiefgelaufen ist. Chesney weist auch auf einige korrekturbedürftige Fehlentwicklungen hin. Er macht es sich allerdings zu einfach. Zum einen erweckt er den Eindruck, als ob im Finanzsektor jemals Liberalismus in Reinkultur oder übertriebener Liberalismus geherrscht habe. Zum andern führt er alle Probleme auf ein Marktversagen zurück, weil der Preisbildungsmechanismus auf den Finanzmärkten (wofür der Hochfrequenzhandel dient) defekt sei und diese sich vom Geist des Unternehmertums entfernt hätten. Ebenso wichtig oder noch wichtiger waren jedoch das Staatsversagen und die durch Regulierungen verursachten Fehlanreize. Nicht nur ist es waghalsig, die stark gestiegene Verschuldung von Ländern und Banken einfach anonymen «Mächten» des Finanzmarktes und damit dem Liberalismus (oder der neoliberalen Politik?) anzulasten. Chesney verschweigt auch, dass der Aufstieg der Rating-Agenturen zu einem grossen Teil den staatlichen Behörden Amerikas zu verdanken ist, die diesen bei der Risiko- Bewertung hoheitliche Aufgaben übertragen haben. Wenn die Verfolgung individueller Interessen angeblich immer mehr dem Gemeinwohl schadet, würde man schon gerne wissen, was im Urteil des Autors dieses Gemeinwohl eigentlich ist.
Notwendige Korrekturen
Es ist unbestritten, dass es im Finanzmarkt Korrekturen braucht. Freiheit und Verantwortung als marktwirtschaftliche Ordnungsprinzipien müssen auch im Finanzsektor konsequent durchgesetzt werden. Mit anderen Worten: Banken müssen, wie wir etwa zuletzt in der Avenir-Suisse-Publikation «Ideen für die Schweiz» dargelegt haben, auch in Konkurs gehen können. Es braucht mehr und qualitativ besseres Eigenkapital. Anstelle des komplexen, undurchsichtigen Basler Ansatzes braucht es gescheitere, einfachere Regulierungen, welche die Verschuldungsmöglichkeiten der Banken beschränken. Besonders wirkungsvoll und zielführend ist eine im Vergleich zu heute deutlich höhere ungewichtete Eigenmittelquote. Die Diskussionen über weitere Vorschläge zur Regulierung des Finanzsektors sind in vollem Gang (höhere Transparenzanforderungen, Einrichtung von «Clearing »-Stellen usw.). Darauf geht Chesney mit keinem Wort ein es bleibt ein Rundumschlag ohne Analyse und ohne Perspektive.
Dieser Artikel erschien in der Neuen Zürcher Zeitung vom 24. Juli 2013. Mit freundlicher Genehmigung der Neuen Zürcher Zeitung.