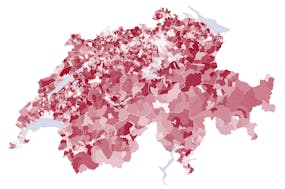Handelszeitung: Schwyz hat für eine Reichensteuer gestimmt. Diverse Kantone budgetieren für 2015 rote Zahlen. Hat die Steuererhöhung in Schwyz Vorbildcharakter?
Lukas Rühli: Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Zeit der grossen Steuersenkungen vorbei ist. Der Finanzausgleich von 2008 hat den Kantonen einige Freiheiten in der Steuerautonomie gebracht. Entsprechend wurde seitdem etwas experimentiert. Das gilt vor allem für kleine Kantone, die – was ihre natürlichen Standortfaktoren angeht – eher unattraktiv sind. Kantone wie Obwalden, Nidwalden, Schwyz, Appenzell Innerrhoden oder Appenzell Ausserrhoden haben dann versucht, Unternehmen mit niedrigeren Steuern anzulocken.
Das hat zu einer Welle an Steuersenkungen geführt. Ist das Experiment «Race-to-the-bottom» gescheitert?
Ich würde das nicht ein «Race-to-the-bottom» nennen. Der Begriff ist negativ behaftet. Die besagten Kantone haben einfach versucht, ihre fehlenden Standortvorteile zu kompensieren. Das ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern sogar wünschenswert.
Wächst die Gefahr, dass diese Kantone wirtschaftlich an Boden verlieren und Jobs verloren gehen, wenn sich Unternehmen aus Steuergründen verabschieden?
Gesamtschweizerisch ist die Arbeitslosigkeit sehr niedrig. In den vergangenen Jahren konnten viele der neu geschaffenen Arbeitsplätze überhaupt nur dank der Zuwanderung besetzt werden. Gesamthaft ist die Angst also eher unbegründet. Regionalpolitisch hingegen kann das Auswirkungen haben. Durch die Niedrigsteuerstrategie kamen zumeist aber ohnehin sehr mobile Unternehmen, die nur wenige Arbeitsplätze für Einheimische geschaffen haben und nicht in der Region verwurzelt sind.
Wenn der Steuerwettbewerb aber in erster Linie Firmen angezogen hat, die kaum Jobs geschaffen haben: Welche nachhaltigen Vorteile hat denn der Steuerwettbewerb?
Der Steuerwettbewerb ist ein wichtiger Aspekt des Standortwettbewerbs. Dieser treibt die die Kantone und Gemeinden an, möglichst attraktive Produkte möglichst günstig zu verkaufen, was letztlich zum Wohl aller ist. Es gibt aber verschiedene Strategien. Wegen ihrer Standortvorteile haben Zürich oder Genf Premiumprodukte. Diese Kantone müssen sich teuer verkaufen, sonst würden sie laufend Defizite fahren. Andere Kantone verkaufen sich günstiger.
Der Ausblick für die Schweizer Wirtschaft hat sich jüngst eingetrübt, viele Ökonomen haben ihre Wachstumsprognosen deutlich gesenkt. Könnten die Kantonsfinanzen 2015 deshalb vielerorts sogar noch schlechter ausfallen als bislang budgetiert?
Die Konjunktur hat freilich einen Einfluss auf Einnahmen und Ausgaben. Aber Korrekturen hinter dem Komma werden die Finanzierungsaussichten der Kantone voraussichtlich wohl nicht signifikant beeinflussen. Zumal die Kantone in der Regel ohnehin sehr konservativ budgetieren.
Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, wieder schwarze Zahlen zu erreichen?
Gerade in einigen Zentralschweizer Kantonen, die bereits relativ sparsam sind, liegt es nahe, die Einnahmen zu erhöhen. Vor allem, wenn die Steuerbelastung dort niedrig ist. Allerdings muss die Frage gestellt werden, ob ein Defizit partout jedes Jahr vermieden werden muss. Die Schweiz ist in einer extrem komfortablen Situation. Man braucht sich nicht das umliegende Europa als Vorbild nehmen. Aber in der Schweiz wird gerne aufgeschrien, wenn nur ein Defizit angekündigt ist – während man in den meisten EU-Ländern froh wäre, solch niedrige Fehlbeträge zu haben.
Sie empfehlen also eine ruhige Hand?
Man sollte sich nicht zu übertriebenem Alarmismus verführen lassen, wenn die Eigenkapitaldecke zu schmelzen beginnt.
Dieses Interview erschien in der «Handelszeitung» vom 2. Oktober 2014. Mit freundlicher Genehmigung der Handelszeitung.