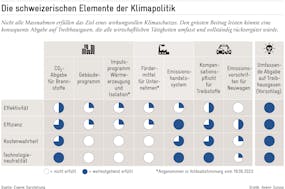Seit die SNB am 15. Januar 2015 beschlossen hat, den Mindestwechselkurs zum Euro aufzugeben, stehen die schweizerischen Parteien Kopf. «Es ist fünf vor zwölf», schrieb etwa die FDP in ihrem Ende Januar verabschiedeten Wirtschaftsprogramm. In Windeseile wurden wirtschaftspolitische Papiere präsentiert. Die Vorschläge sind selten neu, sie werden einfach anders verpackt. Auch sind sie teilweise absurd, wenn etwa ein Mindestwechselkurs von 1,15 gefordert oder flugs eine strikte Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative als Kostensenkungsprogramm verkauft wird. Die für die Frühlingssession von quasi sämtlichen Parteien geforderte dringliche Debatte brachte laut den meisten Beobachtern ebenfalls wenig Neues hervor.
Diese hektischen Bemühungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vorschläge meist nur kurzfristig anstehende Massnahmen auflisten und keineswegs in ein konsistentes Gesamtbild eingebettet sind. In der schweizerischen Politik, so scheint es, ist seit längerem die Fähigkeit abhanden gekommen, Politik auf Grund einer klaren gesellschaftlichen Analyse zu machen und dabei ein Bild der Schweiz der Zukunft vor Augen zu haben. Wäre nicht die aktuelle Frankenstärke wieder ein guter Anlass, um diese gedankliche Arbeit vorzunehmen?
Mehr Mut zum Aufbruch
Blicken wir zurück. 1995 stand die Schweiz vor ähnlichen Herausforderungen. Eine fortdauernde Wachstumsschwäche drohte und die bedächtige, selbstzufriedene Schweiz schien nicht wirklich willens für tiefgreifende Reformen. Die damalige Antwort aus Wirtschaftskreisen, die unter dem Titel «Mut zum Aufbruch» bekannt wurde, machte Furore. Sie war auch heftig umkämpft. Trotzdem aber wurden in der Folge viele Forderungen umgesetzt. Was macht, neben der damaligen ungewöhnlichen Autorenschaft, den Reiz dieses Büchleins aus? Auch heute noch beeindruckt die Aufbruchsstimmung, die in diesem Text zu spüren ist. Da ist vom rasanten weltwirtschaftlichen Strukturwandel «als einmaliger Chance» und von «Gründerzeit» die Rede, und es wird vor «der Versuchung zur Abschottung» gewarnt. Die darin beschriebene Ausgangslage kommt uns auch heute noch recht bekannt vor:
«Wir leben in einer Zeit der Verunsicherung angesichts der immer intensiveren Anwendung neuer Technologien und der daraus resultierenden weltweiten Vernetzung von Produktion und Angebot. Die Distanzen schwinden zusehends, entfernte Volkswirtschaften und Gesellschaften werden zu unmittelbaren Nachbarn und Konkurrenten (…). Diese Studie will das Bewusstsein dafür schärfen, dass diese Umwälzungen einerseits unsere Lebensverhältnisse insgesamt tangieren und andererseits Chancen für unsere Zukunft bieten.»
Aus Sicht des aktuellen politischen Zeitgeists besonders erstaunlich ist der damalige Aufruf zu mehr Offenheit. So forderten die Autoren, Arbeitsbewilligungen für Hochqualifizierte nach Vorlage eines entsprechenden Arbeitsvertrages automatisch zu erteilen. Darüber hinaus sei ein Abkommen mit der EU und vergleichbaren Ländern über die volle Freizügigkeit anzustreben. Zudem lesen wir folgendes zum Verhältnis zu Europa:
«Die Schweiz sollte eine Europapolitik entwickeln, welche mindestens langfristig über den Bilateralismus hinausgeht und zum Multilateralismus zurückführt. Dabei sind die Vor- und Nachteile einer Annäherung an die EU sowohl in politischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht sorgfältig abzuwägen, und jeder muss für sich entscheiden, ob für ihn die Aktiv- oder Passivseite überwiegt. Als Fazit bleibt jedoch festzuhalten, dass die Schweiz eine langfristige Strategie zur Gestaltung ihres Verhältnisses zu Europa entwickeln muss.»
Solch mutige Ansätze früherer Zeiten stehen in deutlichem Gegensatz zu dem, was die Parteien seit dem 15. Januar verlautbarten. Die Schweiz scheint geradezu in einer Denkblockade gefangen, und die Positionierungen der Parteien in der Wirtschaftspolitik sind volatil geworden, nahezu abhängig von Einzelereignissen. Gerade in einem Wahljahr sollten die politischen Parteien zurückfinden können zu einer Rolle, die von ihnen eigentlich zu erwarten wäre. Nicht Panikmache oder kurzfristige Hektik sollten das Ziel sein, sondern einer nachhaltige, konsistente Politik, die vor allem auf die Zukunft ausgerichtet ist. Parteien müssen den Mut aufbringen, Themen ihrer Bedeutung entsprechend anzugehen und nicht erst dann, wenn die mediale Allgegenwärtigkeit sie dringlich erscheinen lassen. Vor allem liberale Wirtschaftspolitik muss einen Fortschrittsglauben verkörpern, denn der Liberalismus ist eine grundsätzlich optimistische Philosophie: Er hat keine Angst vor der Zukunft, sondern sucht nach den sich bietenden Chancen. Auch die Unternehmen und die Wirtschaftsverbände sollten in diesem Geist agieren, besonders nach der Aufhebung des Mindestwechselkurses.
Erste positive Zeichen
Immerhin gibt es seit kurzem einige Hoffnungsschimmer: Die drei grossen bürgerlichen Parteien haben sich zusammengerauft, gemeinsam 13 Forderungen aufgestellt und sich bereit erklärt, diese in der parlamentarischen Arbeit auch gemeinsam umzusetzen. Und ein neuer Verein aus Unternehmern und Politikern will die traditionelle Offenheit der Schweiz stärken und hierfür auch finanzielle Mittel aufwerfen. Auf diesem Weg ist fortzufahren. Wir brauchen erstens mittelfristig orientierte wirtschaftspolitische Vorschläge. Kurzfristig orientierte Forderungen an die unabhängige SNB gehören nicht dazu. Zweitens ist die Globalisierung eine Chance und alles, was unsere Karten auf den internationalen Märkten verbessert, ist vorzunehmen. Und drittens wird die Schweiz dann Erfolg haben, wenn Politik und Wirtschaft wieder konstruktiver zusammenarbeiten.