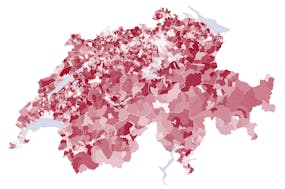Tages-Anzeiger: Wen wählt ein echter Liberaler?
Gerhard Schwarz: In der Realpolitik geht es nicht nur um Weltanschauungen, sondern um Persönlichkeiten und konkrete Probleme. Ich lege nie einfach eine Liste ein: Ich panaschiere und kumuliere.
Gibt es denn Liberale ausserhalb der FDP?
Liberale gibt es in fast allen Parteien, Etatisten gibt es in allen Parteien.
Wie erkennt man die echten Liberalen, wenn alle liberal sein wollen?
Für mich sind die Kernanliegen der Liberalen möglichst viel Eigenverantwortung, Wettbewerb und umfassender Schutz des Privateigentums. Es gibt fast niemanden, der nicht in der einen oder anderen Frage von einem dieser Grundsätze abweicht.
Ganz grundsätzlich: Welche Partei lebt diese Prinzipien am ehesten?
Wahrscheinlich − aber mit sehr viel Zögern und Zweifeln − kommt die FDP meiner Vorstellung von Liberalismus am nächsten.
Ihr altes Stammblatt ist weniger skeptisch mit der FDP. Was halten Sie davon, dass die NZZ unverhohlen Wahlkampf für die FDP macht?
Haben Sie das Gefühl, dass die NZZ offensiv für die FDP wirbt?
Sie kennen sicher den Leitartikel des Chefredaktors mit der Wahlempfehlung für die FDP − und das war nicht der einzige Beitrag.
Ja, ja, ich lese fast alle Leitartikel. Bei der NZZ hat es immer eine Nähe zur FDP gegeben. In meinen 30 Jahren bei der NZZ habe ich aber eine permanente Öffnung und Autonomisierung von der FDP erlebt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich dieser Kurs seit dem Wechsel an der Spitze der Chefredaktion grundsätzlich geändert hat. Der Artikel plädiert ja zugleich auch für zwei SVP-Bundesräte, also eine arithmetische Konkordanz.
Wahlprognosen sagen einen Rechtsrutsch voraus. Das muss in Ihrem Sinn sein.
Ich habe Mühe mit dem Begriff «Rechtsrutsch», weil Liberale weder links noch rechts sind. Ich verwende den Begriff «bürgerlich», was meiner Werthaltung entspricht. Im Moment haben wir eine unglückliche Konstellation, weil das Parlament linker positioniert ist als die Bevölkerung.
Ist die Schweiz dem Etatismus verfallen?
Wir haben zum Glück ein System, das die Macht zwischen Regierung, Parlament und Bevölkerung teilt. Wie ich aus dem Bundesrat höre, fallen dort Entscheide oft mit 5:2 oder 6:1 Stimmen. Früher gab es mehr 4:3-Konstellationen und öfter zugunsten der Bürgerlichen. Wenn die Bürgerlichen bei den Wahlen tatsächlich gewinnen, bildet das Parlament die politische Meinung der Bevölkerung künftig besser ab.
Der Schweiz geht es gut: Die Wirtschaft wächst, das Land ist wettbewerbsfähig, die Frankenstärke scheint gut bewältigt. Weshalb braucht es eine bürgerlichere Politik?
Die Schweiz leidet an Wohlstandsverwöhnung. Wenn man sagt, es gehe uns gut, dann kommen die Reformen zu spät, dann fallen wir zurück. Wir müssen heute Themen anpacken, die in 10 bis 15 Jahren relevant sind. Dazu kommt, dass wir uns zu oft an unseren Nachbarn orientieren, obwohl es nicht die einzigen und vor allem nicht die einzig relevanten Länder sind, an denen wir uns messen sollten.
Eines Ihrer Credos lautet, dass Sie an die Selbstheilung der Märkte glauben…
… Einspruch. Ich halte Marktlösungen einfach für weniger schlecht als staatliche Lösungen. Begriffe wie «Selbstheilung» oder «der perfekt funktionierende Markt» hören Sie von mir nicht. Ich engagiere mich für Marktlösungen, glaube aber nicht, dass der Markt immer perfekte Lösungen liefert.
Bei der Bankenkrise und der Rettung der UBS brauchte es die Hilfe des Staates.
Es ist mir damals nicht leichtgefallen, zu schreiben, dass der Staat intervenieren musste. Doch manchmal ist eine Notoperation notwendig. Wenn ein Arzt ein Bein amputiert, macht er das, weil er den Organismus erhalten will, und nicht, weil er Amputationen gut findet. Das ändert aber nichts am Grundprinzip: Wirtschaft und Gesellschaft sollen so gestaltet werden, dass möglichst wenig interveniert werden muss.
Das ewige Loblied der Deregulierung.
Halt! Man hängt uns Liberalen gern an, wir seien nur für Deregulierung. Es stimmt: Wir glauben daran, dass viele Dinge mit prinzipiellen statt mit detaillierten Regeln geregelt werden sollten. Aber wir sind nicht der Meinung, die Welt könne ohne Regeln funktionieren. Oft sind es einfach die falschen. Nehmen Sie «Treu und Glauben», einen hervorragenden Grundsatz des Schweizer Rechts. Uns reicht dieser Grundsatz: Wir müssen nicht durchdeklinieren, was Treu und Glauben für die Lebensmittelbranche, für die Vergabe von Hypotheken oder den Verkauf einer Maschine heisst.
Was nützt dieser Grundsatz in einer globalisierten Welt? In den USA sichert man sich lieber mit ganz vielen Verträgen ab.
Das stimmt natürlich. Fast alles Gute und fast alles Schlechte kommt aus den USA. Die Überregulierung wurde in jenem Land erfunden, das sich sonst der Deregulierung verschrieben hat. Dabei haben wir schon vor 100 Jahren Handel mit den USA getrieben, und es hat schon damals funktioniert – auch mit unterschiedlichen Rechtssystemen. Heute treibt die Überregulierung absurde Blüten. Ich rede mit Verwaltungsräten, die in ihren Sitzungen nur noch Checklisten abarbeiten. Da wird nicht mehr über Dinge nachgedacht, die vielleicht nicht auf der Liste stehen und viel wichtiger wären. Der gesunde Menschenverstand bleibt auf der Strecke.
Die Finanzkrise konnte Ihren Glauben an den Markt nicht erschüttern. Gab es sonst je eine Phase, in der Sie an Ihren Überzeugungen zweifelten?
Seit 40 Jahren, seit ich mich auf einer grundsätzlichen, fast philosophischen Ebene mit Fragen der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung beschäftige, ringe ich um meine Überzeugungen.
Das verstecken Sie recht gut.
Das mag sein. Für meine Arbeit gilt der NZZ-Werbespruch: Die Arbeit an der Sprache ist Arbeit am Gedanken. Der Freiheitsgedanke ist zentral und zutiefst menschlich. Das ist meine Grundüberzeugung. Meine ganze publizistische Produktion ist ein Kreisen und damit ein Ringen um diese Philosophie einer freien Ordnung. Das wird auch immer wieder auf die Probe gestellt. Ich habe und hatte viele Diskussionen mit Menschen, denen wohl ist, wenn sie nicht immer selber entscheiden müssen. Meine Schwiegermutter war beispielsweise immer froh, wenn man für sie auswählte, was sie im Restaurant essen sollte.
Das muss ein Grauen für einen Liberalen sein.
Ich bin ein kulinarisch interessierter Mensch. Sie war meist zufrieden mit meiner Auswahl. (lächelt)
Man nennt Sie «neoliberal». Ein Schimpfwort?
Für mich nicht, aber für jene, die mich so nennen. Man muss das Wort in seiner ideengeschichtlichen Entwicklung verstehen. In der Zwischenkriegszeit trafen sich in Paris Liberale mit dem Ziel, den klassischen Liberalismus neu zu denken. Nicht radikaler, sondern im Gegenteil: gemässigter. Sie nannten sich Neoliberale. Daraus ist in Deutschland der Ordoliberalismus und schliesslich die soziale Marktwirtschaft entstanden. Man darf mich in diesem Sinne also gern als Neoliberalen bezeichnen.
Den geben Sie allerdings so konsequent, dass man Sie ebenfalls als Ideologen bezeichnet.
Der Ideologievorwurf kommt immer von jenen, die selber eine ziemlich ausgeprägte Ideologie haben. Ich verwende den Ausdruck persönlich nie, «Weltanschauung» trifft es besser. Ich habe immer versucht, eine gewisse Konsistenz in meine Argumentation zu bringen, eine Widerspruchsfreiheit im Denken. Die Suche nach der Widerspruchsfreiheit wird von vielen Menschen als Ideologie verstanden. Für mich hat diese Suche nichts Ideologisches. Persönlich halte ich es für verwerflich, wenn man mit dem Ideologievorwurf Menschen ausgrenzen will. Das zeugt von wenig Respekt und von wenig Verständnis für das zentrale Merkmal einer freiheitlichen Gesellschaft: dem Nebeneinander von unterschiedlichen Meinungen.
Diese Widerspruchsfreiheit verträgt sich allerdings nur schlecht mit dem Schweizer Kompromisssystem.
Ein Kompromiss muss praktisch immer von den idealen Zielen − beider Seiten − abweichen. Sowohl bei der NZZ als auch hier bei Avenir Suisse habe ich publizistisch viel über dieses liberale Ideal nachgedacht, über den Kompass, den man auch deswegen oft gar nicht so schätzt, weil er einem überhaupt erst vor Augen führt, wie weit man mit dem Kompromiss vom idealen Weg und vom Ziel abgekommen ist. Da wurde ich tatsächlich oft missverstanden. Ich wurde als Radikaler dargestellt, dabei habe ich nur über die Orientierungskarte für eine liberale Welt nachgedacht.
Leiden Sie manchmal darunter, wie Sie wegen Ihrer Texte wahrgenommen werden?
Nein. Natürlich ist jeder Mensch gerne beliebt und erhält Anerkennung. Aber ich hätte meine Funktion nicht ausfüllen können, wenn ich Mühe mit Anfeindungen hätte. Die ersten zwei-, dreimal, als jemand über mich schrieb, ohne mit mir zu reden, hat mich das getroffen. Mit dem Alter wird man aber abgeklärter, härter im Nehmen, gelassener.
Sind Sie auch gesellschaftspolitisch liberal?
Ich halte es mit John Stuart Mill: Meine Freiheit endet, wo sie jene eines anderen tangiert. Ich habe zu jenen Redaktoren gehört, die in der NZZ einen Kurswechsel in der Drogenpolitik vollbracht haben. Damals führte ich ein Interview mit Milton Friedman, der für eine Liberalisierung der Drogen eintrat. Das hat mir einige gehässige Reaktionen aus dem konservativen Lager eingebracht − auch in der Redaktion.
Wie beurteilt ein Liberaler die Flüchtlingskrise? Das sind alles Menschen, die ihr Glück machen wollen. Sie müssten alle mit offenen Armen empfangen.
Das ist ein schwieriges Thema, zu dem ich keine endgültigen Antworten habe. Der letztes Jahr verstorbene Nobelpreisträger Gary Becker trat für offene Grenzen ein, wenn sich ein Land so präsentiert wie die USA zur Siedlerzeit: ohne Wohlfahrtsstaat, ohne Eigentumsrechte. Er hat dabei die Indianer vergessen, aber sonst stimme ich ihm zu. Wer hingegen heute zu uns kommt, wandert in bestehende Strukturen ein. Deshalb hat die umstrittene «Club-Theorie» viel für sich: Man darf gern hierherkommen, aber das hat seinen Preis. Es müssen nicht die Migranten selber sein, die diesen bezahlen, das können auch Firmen, Hilfswerke oder Einzelne für sie übernehmen. Bei Kriegsflüchtlingen stehe ich klar zu unserer humanitären Tradition: Hier gilt es zu helfen, so gut man kann.
Ein Glück für uns, dass wir schon im Club sind.
Das ist so. Mich stört aber etwas Ihr moralisierender Unterton. Wer weltweite Chancengleichheit will, sollte sich über einige Fakten klar werden: Die ärmsten fünf Prozent der Schweizer leben besser als drei Viertel der Menschheit, und sie sind im Durchschnitt reicher als die 50 Millionen reichsten Inder. Das wird sich nicht dadurch ändern, dass wie unseren «Club» völlig öffnen, sondern dadurch, dass die Schwellenländer und die Entwicklungsländer weiterhin so dynamisch unterwegs sind und wir sie nicht mit unserem Protektionismus behindern. Die entscheidende Frage ist für mich jedoch ohnehin, wie wir das schlimmste Elend, die ganz grosse Armut ausmerzen können. Da haben wir in den letzten Jahrzehnten gewaltige Fortschritte gemacht: Hunderte von Millionen Menschen sind aus der Armut herausgewachsen. Das ist mein sozialer Ansatz. Wir sollen nicht alle gleich werden, aber wir müssen verhindern, dass die Menschen unter eine bestimmte Schwelle fallen.
Dieses Interview erschien im «Tages-Anzeiger» vom 19. Oktober 2015. Mit freundlicher Genehmigung des Tages-Anzeigers.