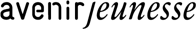Kennst Du zwei oder mehr Paragraphen der Bundesverfassung? Weisst Du, worum es im Kalten Krieg ging? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch! Du wurdest soeben als kompetent genug eingestuft, um das Stimm- und Wahlrecht zu erhalten.
Was im ersten Moment etwas absurd klingen mag, wird nicht erst seit dem Brexit, Donald Trump oder der Masseneinwanderungsinitiative diskutiert: Sollen auch jene in einer Demokratie abstimmen dürfen, die nicht genau wissen, worüber sie entscheiden?
Die Idee einer Experten-Diktatur, einer sogenannten Epistokratie (altgriech.: episteme: «Wissen», kratia: «Herrschaft»), geistert bereits seit langem in den Köpfen einiger Denker umher. Bereits vor 2400 Jahren schlug beispielsweise der griechische Philosoph Platon vor, dass der Staat von «Philosophenkönigen» geleitet werden soll. Klar separiert von anderen Klassen der Gesellschaft, sollen sie von Geburt auf mittels anspruchsvoller Ausbildung auf diese Aufgabe vorbereitet werden. Da sich Philosophen (altgriech.: «Freunde der Weisheit») ihr gesamtes Leben lang der Weisheit widmen, werden sie folglich in der Regierung das Wohl des Gemeinwesens und der Bürger im Blick haben. Und auch im 19. Jahrhundert, z.B. beim englischen Philosophen und Urvater des Liberalismus, John Stuart Mill, finden sich Ansätze, welche in die Richtung einer Epistokratie weisen. So sollen beispielsweise Gebildete mehr Stimmen erhalten, um damit der ungebildeten Masse zu besseren Entscheidungen zu verhelfen.
Hobbits, Hooligans und Vulkanier
Ein Denker, der sich aktuell mit der Idee der Epistokratie auseinandersetzt, ist der amerikanische Politologe Jason Brennan. In seinem neuen Buch «Gegen Demokratie – Warum wir die Politik nicht den Unvernünftigen überlassen dürfen» spricht er sich radikal gegen das allgemeine Wahlrecht aus. Ziel des Buches ist einerseits, die Argumente zugunsten der Demokratie zu entkräften und andererseits, gute Gründe dafür anzugeben, warum wir die Herrschaft den Wissenden überlassen sollten. Doch gelingt ihm dieses Unterfangen, und sollten wir tatsächlich ein Quiz vor den nächsten Abstimmungen einbauen?
Zu Beginn des Buches unterteilt Brennan die Stimmbevölkerung in Hobbits, Hooligans und Vulkanier. Diese drei Gruppen zeigen unterschiedliches Wahlverhalten und weisen unterschiedlich ausgeprägte soziologische, ökonomische und historische Kenntnisse auf:
Die Hobbits sind die apathischen Wähler. Sie besitzen nur geringes politisches Wissen und haben keine klare, feste Meinung zu politischen Fragen. Dies entspricht dem typischen Nichtwähler. Hooligans dagegen sind die «Sportfans der Politik». Mit klaren und unveränderlichen Meinungen prägen sie den politischen Diskurs. Leider sind sie nicht in der Lage, Fakten, die ihren Ansichten widersprechen, in ihre Überlegungen miteinzubeziehen oder auf alternative Standpunkte einzugehen. Hooligans korrespondieren mit den regelmässigen Wählern oder Parteimitgliedern. Zu guter Letzt gibt es noch die Vulkanier. Sie argumentieren in politischen Diskussionen vollkommen rational und wissenschaftlich. Ihre Überzeugungen können sie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen belegen und bei Bedarf auch revidieren. Diesen Idealtypus eines Wählers, stellt Brennan fest, gibt es nicht. Dennoch sollten wir versuchen, ihm möglichst nahezukommen.
Sind die Argumente für die Demokratie überzeugend?
Ausgehend davon unterzieht Brennan drei Rechtfertigungsansätze für die Demokratie einer kritischen Reflexion. Welche Argumente, die für die Demokratie sprechen, identifiziert Brennan, und wie versucht er sie zu entkräften?
Zum einen gibt es eine ethische Begründung der Demokratie. Hier ist Demokratie und eine damit einhergehende umfassende politische Beteiligung sinnvoll, da jene die Bürger erzieht, aufklärt und zu edleren Menschen macht.
Wenn beispielsweise über eine Reform der Sozialwerke abgestimmt wird, so ist damit die Hoffnung verbunden, dass die Stimmbürger sich darüber Wissen aneignen und den eigenen Horizont erweitern. Über zwei Kapitel zeigt Brennan anhand unzähliger Studien und mittels mikroökonomischer Theorie, dass viele Bürger trotz politischer Partizipation sich nicht zusätzliches Wissen aneignen und es sich für sie auch nicht lohnt, dies zu tun. Die Demokratie führe also nicht zwangsläufig zu einer aufgeklärteren Gesellschaft. Im Gegenteil, sie mache uns gar zu schlechteren Menschen: «Wenn gemeinsames Beratschlagen der Bürger nicht bildet […], dann bedeutet dies, dass die Deliberation die Situation verschlechtert.»[1]
Denn aus Sicht Brennans würden die meisten Menschen durch die gemeinsame Diskussion ihre Position nicht überdenken oder andere Meinungen in ihre Überlegungen miteinbeziehen, sondern stattdessen weiter auf ihrer Position beharren. Sie wandeln sich durch die gemeinsame Deliberation viel eher vom Hobbit zum Hooligan als zum Vulkanier. Brennans (provokanter) Schluss: In demokratischen Gesellschaften sind die meisten Wähler «unwissende, irrationale, schlecht informierte Nationalisten»[2] und die Demokratie macht alles noch schlimmer.
Wenn die Demokratie zwar nicht das Wissen fördert, kann sie dann an sich gut sein? Das zweite Argument besagt, dass das allgemeine Wahlrecht ein Symbol der Menschenwürde darstellt. Dass alle ein und dasselbe Wahlrecht haben, kommt ihnen aufgrund ihrer Gleichheit, ihrer Menschenwürde zu. Folglich verstosse eine Abschaffung der Demokratie gegen die Menschenwürde. Hier wendet Brennan ein, dass abgesehen davon, dass selbst diese Position rechtfertigungswürdig sei, dies auch aufgrund eines kulturellen, psychologischen Prozesses so sein könnte. Wir hätten über die Zeit hinweg begonnen, die Menschenwürde mit dem Wahlrecht zu verknüpfen. Man könnte sich ebenso gut vorstellen, dass das Wahlrecht nichts anderes sei als eine Zulassung für Ärzte oder ein Führerschein. Es stelle sich die Frage, ob es moralisch erforderlich ist, dass wir Gleichheit auf diese Art ausdrücken, oder ob nicht auch andere Formen denkbar seien.
Alles schön und gut, aber die Demokratie bringt doch stabile Resultate? Wir haben keinen Bürgerkrieg, keine Hungersnot und leben in Wohlstand. Könnte nicht dies eine Rechtfertigung für die Demokratie sein? Bei diesem Argument verweist Brennan darauf, dass vielerorts die Demokratie nur deshalb gute Ergebnisse zeige, da die Entscheidungen der Wähler nur teilweise oder gar nicht umgesetzt werden. In der Realität herrsche bereits eine Form der Epistokratie vor. Folglich könne man dies ebenso gut auch auf institutioneller Ebene festhalten.

Demokratie ist ein System, in dem Güter, Wertvorstellungen und Meinungen gegeneinander abgewogen werden und sich im Wettbewerb beweisen müssen. (Bild: Fotolia)
Institutionalisierung der Epistokratie
Brennan gesteht ein, dass es schwierig einzuschätzen ist, ob die Epistokratie besser als die Demokratie funktionieren würde. Auch in einem solchen System ist es beispielsweise denkbar, dass nicht alle Hooligans zu Vulkaniern werden. Trotzdem, so lautet seine Überzeugung, sollten wir es wagen, die Demokratie durch eine Epistokratie zu ersetzen. Dies jedoch immer unter der Voraussetzung, dass die Epistokratie schliesslich die besseren Ergebnisse erzielt als die Demokratie.
Zum Schluss präsentiert der Autor einige Vorschläge, wie eine solche Regierungsform ausgestaltet sein könnte. Diese bleiben jedoch etwas skizzenhaft. Hier eine kleine Auswahl möglicher Varianten: So könnten beispielsweise die Bürger ihr aktives und passives Wahlrecht nur erhalten, nachdem sie mittels eines geeigneten Verfahrens als kompetent eingestuft worden sind. Eine andere Variante entspricht jenem Vorschlag Mills, der zwar jedem Bürger ein Wahlrecht zugesteht, aber bei dem die Kompetenteren zusätzliche Stimmen erhalten. Oder man entscheidet sich für eine Stimmrechtslotterie, bei welcher das Wahlrecht unter einigen tausend Bürgern ausgelost wird. Die Gewinner müssen dann jedoch an bestimmten Massnahmen teilnehmen, die ihre Kompetenzen fördern sollen, wie beispielsweise an Foren, bei denen sie gemeinsam diskutieren.
Kritik
Was ist von Brennans Vorschlägen zu halten? Aufgrund ihrer Skizzenhaftigkeit sind sie nur schwer zu beurteilen. So ist beispielsweise noch unklar, wer festlegt, welches Wissen relevant ist oder was mit Minderheiten passiert, die durch ihren schlechteren sozioökonomischen Status einen erschwerten Zugang zu Bildung haben. Werden diese dann permanent von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen? Dennoch lassen sich einige grundsätzliche Einwände gegen Brennans Gedankengebäude vorbringen. So ist Brennans Definition der Demokratie zu eng gefasst. Dadurch, dass er Demokratie als simples Input-Output-System versteht, ignoriert er den gesamten deliberativen Prozess, der vor einer Abstimmung oder einer Wahl stattfindet. Demokratie ist mehr als eine Maschine. Es ist ein System, in dem Güter, Wertvorstellungen und Meinungen gegeneinander abgewogen werden (Freiheit des Individuums vs. Sicherheit) und sich im Wettbewerb beweisen müssen. Auch wenn Brennans Einwand hier z.T. gerechtfertigt ist, dass in einer Demokratie die Menschen eher als Hooligans statt als Vulkanier miteinander diskutieren, so verkennt er dennoch, dass es in einer Demokratie nicht nur um Fakten geht.
Brennan suggeriert, dass politische Entscheidungen nur entweder richtig oder falsch sein können. Doch politische Fragen haben immer auch einen gewissen normativen Gehalt. Anders als in der Wissenschaft geht es nicht (nur) um die Beobachtung von sozialen Phänomenen, sondern es muss immer auch verhandelt werden, was die Ziele und Werte einer politischen Gemeinschaft sind. Oder anders gefragt: Was wäre denn eine «richtige» Lösung bei der Frage: Soll eine Helmpflicht für Velofahrer eingeführt werden? Wir müssen Werte wie «Freiheit des Individuums» gegenüber den höheren Kosten für die Gesellschaft abwägen.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass selbst Platon seine Ansichten zur Epistokratie einige Jahre später revidierte.
[1] Brennan, 2017, S.125; [2] ibid., S. 45.