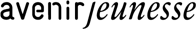Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheitsrechte sind grundlegende Elemente unseres Staatswesens, die uns natürlich und unerlässlich erscheinen. Tatsächlich sind sie aber alles andere als selbstverständlich. Um ihre Entwicklung und Verwirklichung mussten viele kluge Köpfe lange Zeit ringen – und auch in Zukunft ist Engagement für die Freiheit erforderlich.
Einlaufen
Die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland ist in vollem Gange. Während sich Lichtsteiner, Shaqiri und Co. anstrengen, um die nächste Runde zu erreichen, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, welche elf Persönlichkeiten ein Liberaler auf den Platz stellen würde. Denn Fussball und Liberalismus haben manchmal mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint.
Zum einen ist da der Schiedsrichter. Greift dieser ins Spielgeschehen ein, so sorgt er regelmässig für Ruhe und Ordnung. Gerät der Schiedsrichter jedoch zu stark in den Vordergrund, ist das meist kein gutes Zeichen. Es besteht die Gefahr, dass er das Spiel «zerpfeift», den Wettkampf dadurch verzerrt und den Spielfluss hemmt. Aus Sicht eines Liberalen nimmt der Staat in unserem täglichen Leben eine ähnliche Rolle ein. Er gewährleistet den geordneten Betrieb und bietet uns einen sicheren Rahmen für unser Leben, Handeln und Arbeiten. Wird der Staat aber zu gross und zu mächtig, ist die persönliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Freiheit gefährdet.
Der Grundgedanke beim Sport ist, dass das bessere Team oder der bessere Spieler unter bestmöglicher Unterhaltung des Publikums gewinnt. Ganz ähnlich hofft auch ein Liberaler, dass sich die besten Produzenten mit den überzeugendsten Produkten auf dem freien Markt beweisen, damit Güter und Dienstleistungen effizient bereitgestellt und optimal verteilt werden und so der individuelle und allgemeine Wohlstand wächst.

Fussball und Liberalismus haben manchmal mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint. (Quelle: Fotolia)
Ankick zum liberalen Rechtsstaat
Der Engländer John Locke (1632 – 1704) gilt als Vater des englischen Liberalismus. Neben Überlegungen zur Erkenntnisfähigkeit des Menschen dachte er über die vernunftgemässe und rechtmässige Begründung und Legitimation von Herrschaft sowie über die Beschränkung der Regierungsmacht nach.
Im Werk «Zwei Abhandlungen über die Regierung» bricht er mit der zu seiner Zeit verbreiteten Vorstellung, dass Könige Kraft göttlicher Gnade in ihr Amt eingesetzt werden, ihre Macht absolut sei und willkürlich ausgeübt werden dürfe. Das Recht zu regieren fällt, so die Meinung von Locke, Königen nicht vom Himmel in den Schoss, sondern wird begründet und beschränkt durch den Auftrag der Regierten an die Regierenden, die Werte Leben, Freiheit und Eigentum zu schützen. Zwischen Volk und Regierung gibt es nach seinem Verständnis also einen Herrschaftsvertrag (heute: Verfassung). Damit verfolgt er ein Konzept, dass wir Rechtsstaatlichkeit nennen.
Aber warum wollen Menschen überhaupt eine Regierung, bzw. einen Staat? Ohne Staat – im sogenannten Naturzustand – seien die Menschen, so Locke, grundsätzlich am freiesten. Da es bei Streitigkeiten jedoch keine rechtsprechenden und rechtsdurchsetzenden Instanzen gebe, drohen Streitereien auszuarten und in Kriege zu münden. Diese würden die oben genannten freiheitlichen Werte gefährden. Es liege deshalb im Eigeninteresse der Menschen, sich eine Regierung zu geben.
Ganz Realist, wusste Locke, dass Macht Menschen und insbesondere Regierungen korrumpieren kann. Um das Abdriften der Regierung ins Absolutistische zu verhindern, konzipierte Locke ein gewaltenteiliges Regierungsmodell. Umgesetzt wurde dieses Konzept in modernen westlichen Verfassungsstaaten durch die Trennung der Staatsgewalt in Exekutive, Legislative und Judikative.
Steilpass für die Demokratie
Der Genfer Denker Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) hatte ein sehr bewegtes und unstetes Leben. Durch seine zahlreichen Schriften zu Gesellschaft, Staat und Politik erlangte er bereits zu Lebzeiten grosse Bekanntheit und provozierte mit seinem radikalen Freiheitsdenken die Mächtigen seiner Zeit. Er überlegte sich, wie eine staatliche Herrschaft eingesetzt werden könne, ohne dass die Bürger ihre Freiheit verlieren. Sein in der Schrift «Vom Gesellschaftsvertrag» entworfenes Konzept basierte auf der Überlegung, dass nur diejenigen Bürger politisch frei sein können, die sich ihre Gesetze selber geben. Damit wurde er zum Vordenker der Demokratie, wie sie sich mit der französischen Revolution durchzusetzen begann.
Den Spielfluss nicht störe
Der Schotte Adam Smith (1723 – 1790) gilt als Urvater der Nationalökonomie, heute Volkswirtschaft genannt. Im Gegensatz zu den damals wichtigen Wirtschaftstheorien des Merkantilismus und der Physiokratie, die den nationalen Geldvorrat, bzw. die Landwirtschaft als Quelle der nationalen Wertschöpfung und des Wohlstands ins Zentrum stellten und protektionistische Massnahmen befürworteten, stützte Smith seine Theorie auf Arbeit und freie Marktwirtschaft ab: Dadurch, dass sich Produzenten spezialisieren, können sie Güter effizienter herstellen und am Markt tauschen. Das Bild der unsichtbaren Hand zur Beschreibung der Marktmechanismen, wie er es in seinem Werk «Über den Wohlstand der Nationen» verwendet, wurde berühmt: Indem die Marktteilnehmer ihre Produktivität aus eigenem Interessen steigern, tragen sie zum allgemeinen Wohlstand bei – besser als dies durch eine ausgeprägte Interventionspolitik des Staates erreicht werden könnte. Der Zweck des Staates beschränke sich deshalb auf Grundfunktionen wie die Landesverteidigung oder die Bereitstellung eines Rechts- und Bildungswesens.
Dem Schnüffelstaat die rote Karte zeigen
Die Fragen «Was kann ich wissen?», «Was soll ich tun?» und «Was darf ich hoffen» beschäftigten Immanuel Kant (1724 – 1804) als Denker der Aufklärung stark. Gemäss der Einstellung, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, setzte er sich mit der Philosophie seiner Zeit auseinander, kritisierte und begründete sie sozusagen neu. Seine Überlegungen zu Recht und Ethik und ihrer Unterscheidung sind für das moderne liberale Verständnis von Rechtsstaatlichkeit fundamental. Das Recht betrifft gemäss Kant nämlich nur die äussere Beziehung der Menschen zueinander und verlangt nicht, dass sie die Regeln aus innerer Überzeugung befolgen. Übertragen auf den Fussball: Ob ein Fussballspieler auf das Niedergrätschen des Gegenspielers verzichtet, weil er das Verbot gut findet oder aus Furcht vor den Sanktionen, ist rechtlich gesehen unwesentlich. Beide Male ist das äussere Verhalten das Gleiche und regelkonform. Die Einhaltung rechtlicher Normen kann kontrolliert und erzwungen werden, weil sie auf das Verhalten der Menschen abzielen und nicht auf deren Gesinnung.
Die Existenz und die Erfüllung ethischer Pflichten – Moralität (Tugend) – hingegen ist nur möglich, wo Menschen innerlich davon überzeugt sind, dass es sie gibt und dass sie gut sind, d.h. dass sie die Pflichten ihrer selbst willen befolgen. Aufgrund dieser Innerlichkeit entzieht sich die Moralität der Kontrollier- und Erzwingbarkeit und damit dem Staat weitestgehend. Denn will ein Staat Moralität durchsetzen, müsste er wissen, was einzelne Menschen denken und fühlen und darauf Einfluss nehmen. Welche negativen Konsequenzen damit einhergehen, zeigten die totalitären Staaten im 20. Jahrhundert.
Kants Überlegungen führen zu einem Staatskonzept, das sich auf die Legalität des Verhaltens seiner Bürger konzentriert und darauf verzichtet, Menschen in ihrem Innersten zu erfassen und gegebenenfalls umzupolen. Dies ist letztendlich eine Absage an den «Schnüffelstaat», der die Gesinnung seiner Bürger ins Visier nimmt, und ein Plädoyer für die ethische und religiöse Neutralität des Staates. Da Glücksvorstellungen individuell und damit in einem Volk plural sind, tut ein Staat unrecht und behandelt seine Bürger als Unmündige, wenn er sich die Beförderung des Volksglücks auf die Fahne geschrieben hat.
Der Spielmacher
Ohne einen guten Spielmacher steht ein Fussballteam auf wackeligen Füssen. Es braucht jemanden in seinen Reihen, der das Spiel lesen und anhand dieser Analyse Angriffe forcieren oder Defensiven einleiten kann, aber auch nicht davor zurückschreckt, selber Tore zu schiessen. Benjamin Constant (1767 – 1830) kann wohl als Spielmacher in der liberalen Elf bezeichnet werden. In Lausanne geboren, lebte er in Deutschland, England und Frankreich und lernte deshalb die verschiedenen aufklärerischen und liberalen Strömungen kennen. Dies ermöglichte es ihm, sich kritisch mit den Theorien eines Rousseaus, Kants und Humboldts auseinanderzusetzen, diese weiterzuentwickeln, wenn nötig dagegen zu argumentieren sowie ein eigenes umfassendes liberales Denken zu entwickeln. Tief geprägt vom Terreur der französischen Revolution, machte er – wie John Stuart Mill (siehe unten) – darauf aufmerksam, dass keine Herrschaft unbegrenzt sein sollte, auch nicht eine demokratische. Damit kritisierte er auch Rousseaus Konzept der übermächtigen «volonté générale». Als Anführer der liberalen Partei in Paris und Parlamentarier nahm er auch direkten Einfluss auf die Tagespolitik.
Die weiteren Mitglieder der liberalen Elf werden nach einer «Halbzeitpause» in Teil 2 vorgestellt.