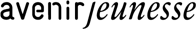Der Begriff «Liberalismus» ist so schwer fassbar wie ein glitschiger Fisch. Die unterschiedlichsten politischen Strömungen nehmen für sich in Anspruch, «liberale» Werte zu vertreten – und leiten daraus die verschiedensten Handlungsmuster ab. Mit einer kleinen Tour d’ Horizon zum Begriff sollen zentrale liberale Eigenschaften charakterisiert werden.
Eine liberale Weltanschauung geht grundsätzlich von einem freien Menschen aus. Entsprechend bedarf jede Beschneidung von Freiheit einer besonderen Rechtfertigung. Der Einzelne besitzt unveräusserliche Rechte wie Meinungsfreiheit, körperliche Unversehrtheit oder Würde. Wird er angeklagt, steht ihm ein ordentliches Gerichtsverfahren zu. Jeder Mensch wird als mündige Person angesehen, die fähig ist, selbstständig ein gutes Leben zu führen. Der Staat hat sich aus liberaler Perspektive aus jedem persönlichen Lebensentwurf herauszuhalten.
Wer Zwang ausüben, dem Individuum die Selbstverantwortung entziehen und somit seine Freiheitsrechte verletzen will, braucht dafür gute Gründe. Politische Autorität und das Gesetz benötigen folglich eine Rechtfertigung, um in die Rechte des Individuums eingreifen zu dürfen. Bekannte Philosophen, die politische Autorität auf der Basis von liberalen Prinzipien zu legitimieren versuchten, sind u.a. John Locke, Jean-Jacques Rousseau oder Immanuel Kant.
Als Liberale könnten wir also jene bezeichnen, die an die Freiheit glauben. Für diese Menschen ist Freiheit nicht bloss eine Worthülse, sondern ein Wert, den es zu verteidigen gilt. Die Krux an dieser Definition ist, dass die Ansichten darüber, was Freiheit ist, weit auseinander gehen. Entsprechend unfassbar ist der Begriff des Liberalismus.

Die Freiheitsstatue in New York verkörpert Libertas, die römische Göttin der Freiheit. (Quelle: Fotolia)
Generell unterscheidet man zwischen dem negativen, dem positiven und dem republikanischen Freiheitsbegriff. Während bei der negativen Freiheit insbesondere die Abwesenheit von Zwang betont wird, also die «Freiheit von …», zeichnet sich die positive Freiheit durch die Möglichkeit aus, die eigenen Ziele auch tatsächlich verfolgen zu können. Man könnte hier von «Freiheit zu …» sprechen. Bei der republikanischen Freiheit schliesslich geht es darum, dass Freiheit primär Nicht-Beherrschung bedeutet. Frei ist hier jemand, der nicht potenziell der Willkür eines anderen unterworfen ist.
Doch nicht nur im Verständnis von Freiheit unterscheiden sich «Liberale». Auch über die Bedeutung des Privatbesitzes für die individuelle Freiheit haben sich über die Zeit unterschiedliche Ansichten entwickelt.
Im klassischen Liberalismus sind die Eigentumsrechte eng mit dem Konzept der Freiheit verbunden. Ihnen zufolge ist die individuelle Freiheit nur mit einem Wirtschaftssystem möglich, das auf Privateigentum basiert. Dies erlaubt es dem Individuum, sein Eigentum so einzusetzen, wie es dies für richtig hält. In diesem Punkt reicht das Spektrum der Ansichten vom Fast-Anarchisten über den Libertären, der lediglich eine Besteuerung vom Staat für die Sicherung der Freiheit und der Eigentumsrechte akzeptiert, bis hin zum Liberalen, der für ein soziales Minimum argumentiert.
Gelegentlich unterstützten Liberale im 19. Jahrhundert gar die Gewerkschaftsbildung, gemäss Jeremy Benthams Diktum, das Ziel sei nicht, die Reichen ärmer zu machen, sondern die Armen reicher. Dies bedeutete konsequenterweise aber auch die Ablehnung der Umverteilung durch den Staat. Denn die Angleichung der Einkommensverteilung würde nur zu einer Minimierung der Gesamtwohlfahrt führen und damit nicht den gesellschaftlichen Nutzen maximieren.
Im neueren Liberalismus des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts wird die Verknüpfung zwischen individueller Freiheit und Privatbesitz zunehmend infrage gestellt. Man beobachtete, dass die freie Marktwirtschaft nicht nur stabile Resultate hervorbrachte und auch mit einer hohen Arbeitslosenrate einhergehen konnte, insbesondere mit Blick auf die «Great Depression» zu Beginn der 1930er Jahre. Gleichzeitig stieg das Ansehen des Staates durch die Demokratisierung westlicher Staaten. Schliesslich gelangte man zunehmend zur Überzeugung, dass Privatbesitz eine Ungleichheit hervorbrachte, die zu weniger Freiheit einer grossen Gruppe von Menschen führte. Daher wird in Amerika unter «liberalism» oft eher eine sozialdemokratische Haltung verstanden. Dies zeigt sich nicht nur bei Verteilungsfragen, sondern auch bei der Regulierung.
Beispiel für einen solchen Liberalen amerikanischer Prägung ist der ehemals in Harvard lehrende Philosophieprofessor John Rawls. Er entwickelte 1971 eine Theorie der sozialen Gerechtigkeit, in der ökonomische Ungleichheiten so arrangiert sein müssen, dass die am meisten Benachteiligten so gut wie möglich gestellt werden. Denn nur einer solchen Regelung würden alle Teilnehmer einer Gemeinschaft in einem fiktiven «Urzustand» zustimmen. Umverteilung hat bei Rawls also durchaus ihren Platz – doch wie tiefgreifend sie sein soll, darüber gehen die Interpretationen stark auseinander. Als Liberaler betont er dabei jedoch, dass jedes Individuum primär Anspruch auf Zugang zum gleichen System von Grundfreiheiten haben müsse.
Einen Konsens zum Begriff «Liberalismus» zu finden, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Unbestritten ist am ehesten die Vorstellung, dass die Freiheit des Einzelnen geschützt werden soll, und jegliche Beschränkung einer rechtmässigen Begründung bedarf. Darüber hinaus sollte die Lage der Ärmsten verbessert werden – jedoch nicht nur auf Kosten der Reichsten. Die Auffassungen über den Weg zu diesem Ziel sind so unterschiedlich wie die Gruppierungen, die sich liberalen Werten verpflichtet fühlen. Doch ohne die liberale Emanzipation wären die meisten Menschen in westlichen Gesellschaften wohl nach wie vor als Leibeigene abhängig von Feudalherren und Adligen. Erst der Liberalismus hat es erlaubt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen – auch wenn wir als Konsequenz davon manchmal die falsche Entscheidung treffen.