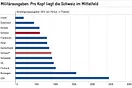«Stabilität braucht Schutz.»
Dieser Satz stammt von Steffen Kampeter, dem parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium für Finanzen und dient der Rechtfertigung zur Schaffung des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM (vgl. FAZ vom 3.8.2012). Dieser soll den ursprünglich nur als Provisorium gedachten Rettungsfonds EFSF als Stabilitäts- und Schutzmechanismus der Wirtschafts- und Währungsunion ersetzen.
Die Eurokrise ist vor allem eine Vertrauenskrise
Die Aussage irritiert aus ökonomischer Sicht. Denn Stabilität – ob in der Geld- oder Finanzpolitik – ist in aller Regel weniger das Resultat von Garantien, Kreditlinien und Schutzmechanismen, sondern das Ergebnis einer überzeugenden, zielorientierten Politik. Diese fusst auf Berechenbarkeit und Glaubwürdigkeit der handelnden Akteure, Transparenz und Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit. Das schafft Vertrauen und lässt bei der Bevölkerung nicht das Gefühl aufkommen, von der Politik hinters Licht geführt zu werden. Zu erwähnen ist dies deshalb, weil die Krise im Euroraum im Kern eine Vertrauenskrise ist.
Auch wenn der Euro im Jahr 1998 als politisches Projekt startete und die Euro-Zone kein optimaler Währungsraum war, so waren die Geschäftsgrundlagen und Verantwortungen eigentlich klar festgelegt und verteilt. Für den Beitritt waren die Konvergenzkriterien massgeblich: Preisstabilität (nur 1,5% über der Inflation der drei preisstabilsten Mitgliedsländer), Haushaltsdisziplin (jährliches öffentliches Defizit von 3%) und öffentlicher Schuldenstand (nicht mehr als 60% des BIP). Trotz einer einheitlichen Geldpolitik im Währungsgebiet blieb die finanz- und wirtschaftspolitische Verantwortung bei den Mitgliedstaaten. Weil aber finanz- und wirtschaftspolitisches Fehlverhalten einzelner Mitgliedstaaten negative externe Effekten auf Partnerländer haben kann, wollte man mit dem Haftungsausschuss («No-Bail-Out-Klausel») sowohl in der Gemeinschaft als auch in den Mitgliedstaaten das Bewusstsein schaffen, dass die Lasten einer übermässigen Verschuldung nicht durch eine «Vergemeinschaftung» gemildert werden können: Im Rahmen des Europäischen Staats- und Wachstumspakts vereinbarte man Massnahmen zur Koordinierung und Überwachung der Haushaltspolitik und der übrigen Wirtschaftspolitik. Seit 2005 sind zudem Geldbussen von bis zu 0,5% BIP des betreffenden Landes bei finanz- und wirtschaftspolitischem Fehlverhalten möglich. Ausserdem gibt es seither auch integrierte Leitlinien zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung.
Trotzdem lief die Entwicklung aus dem Ruder. Schon vor dem Ausbruch der Bankenkrise im Jahr 2007 war in der Eurozone von Konvergenz wenig zu spüren. Besonders eindrücklich ist dies bei der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer (gemessen an der Entwicklung der Lohnstückkosten) zu sehen, wo sich schon früh eine Schere zwischen dem Süden und dem Norden auftat. Hinzu kamen ab 2008 die staatlichen Banken-Rettungsprogramme und die Konjunkturstützungsmassnahmen, welche die öffentlichen Haushalte stark belasteten. Seit 2010 hat sich auch noch ein grosses Zinsgefälle zwischen Peripherie und Kernländern eingestellt.
Es gibt nur zwei Auswege
All dies muss in Erinnerung gerufen werden, wenn zu den bereits bestehenden Regeln und Vorkehrungen nun mit dem ESM noch ein weiterer Schutzmechanismus hinzu kommen soll. Die Krise im Euroraum ist weniger eine Geschichte fehlender gesetzlicher Vorkehrungen und Schutzmechanismen als eine Geschichte der trickreichen Missachtung und Umgehung von Regeln und Prinzipien. Am Anfang der Regelbrechung stand die Missachtung der Maastricht-Kriterien. Dann erfolgte die Aufweichung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Damit einher ging der Übergang zur Einzelfall-Regelung, was letztlich auch zu einem Verlust an ordnungspolitischem Denken führte. Die Angst der Politik vor möglichen Ansteckungseffekten oder einem Flächenbrand war immer grösser als der Wille, Regeln und Prinzipien der Haftung und der Eigenverantwortung durchzusetzen.
Die Wirtschafts- und Währungsunion kann aber nur funktionieren, wenn sich die Politik an einen konsistenten und glaubwürdigen Ordnungsrahmen hält. Wenn die EU bzw. die Eurozone eine Rechtsgemeinschaft sein will, dann muss sie dies durch ihr Verhalten beweisen. Notverordnungen, Sondergipfel und Rettungseinsätze schaffen weder Vertrauen noch Stabilität. Statt immer neuer Vorkehrungen und Schutzmechanismen wäre es für die Zukunft wohl konsequenter, diejenigen Länder aus dem Euroraum auszuschliessen, die sich nicht an dessen Geschäftsgrundlagen halten. Deshalb gibt es für eine stabile Währungsunion nach Ansicht des Präsidenten der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann auch nur zwei Wege: Entweder zurück zum Maastrichter-Vertrag mit nationaler Eigenverantwortung und konsequenter Umsetzung oder den Übergang in eine stärker integrierte Union mit weitreichenden Eingriffs- und Durchgriffsrechten auf die nationalen Haushalte.