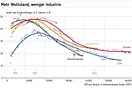Das Kartellrecht dient dem Schutz des Wettbewerbs: Es soll sicherstellen, dass der wirksame Wettbewerb nicht durch einzelne Unternehmen beeinträchtigt wird. Voraussetzung dafür, dass ein Unternehmen den Wettbewerb beeinträchtigen kann, ist Marktmacht. Aus dieser Logik ergibt sich der Fokus des Wettbewerbsrechts auf die Bekämpfung von Abreden (Kartellen), die Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen sowie die Fusionskontrolle. Besonders zwischen Abreden und Fusionen besteht eine enge Beziehung. Die extremste Form einer vertikalen Abrede, also einer Abrede zwischen Unternehmen auf unterschiedlichen Marktstufen (etwa zwischen dem Hersteller und dem Händler eines Produktes), ist die vertikale Integration.
Kostspieliger Leerlauf
Ebenso lassen sich horizontale Abreden – das heisst Abreden zwischen Konkurrenten – als Fusion «tarnen», beispielsweise durch die Gründung eines Joint Venture. Entsprechend würde man annehmen, dass die kartellrechtlichen Eingriffshürden bei Abreden und Fusionen etwa gleich angesetzt wären. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung über die Jahre zusehends zu einem Auseinanderdriften der Eingriffsschwellen geführt. Es begann damit, dass das Bundesgericht im Jahr 2007 die schweizerische Fusionskontrolle mit zwei Urteilen zu einem Papiertiger verkommen liess. Damals entschied das Bundesgericht, dass die Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung nicht wie in allen anderen europäischen Ländern ausreiche, um eine Fusion zu untersagen. Vielmehr müsse die marktbeherrschende Stellung geeignet sein, den wirksamen Wettbewerb komplett zu beseitigen.
Solche extremen Auswirkungen einer Fusion dürften sich in der Praxis kaum jemals beobachten lassen, was auch erklärt, weshalb in der Schweiz seit der Einführung des heutigen Kartellgesetzes nur einmal eine Fusion rechtskräftig untersagt wurde. Angesichts der Tatsache, dass die Fusionskontrolle signifikante Ressourcen bei der Wettbewerbsbehörde bindet und auch bei den Unternehmen erheblichen Aufwand verursacht, muss die derzeitige Situation als kostspieliger Leerlauf bezeichnet werden.
Gesetzesanpassung durch die Hintertür
Im Gegensatz zu dieser toleranten Haltung in der Fusionskontrolle hat das Bundesgericht mit seinem im Juni 2017 veröffentlichten Urteil gegen die Elmex-Herstellerin Colgate-Palmolive die Eingriffshürden bei den Abreden massiv gesenkt. So hielt das Bundesgericht in seinem Leitentscheid fest, dass Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen, bei denen die Vermutung der Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs widerlegt werden kann, ungeachtet ihrer tatsächlichen Auswirkungen als grundsätzlich «erheblich» gelten.
Es lässt sich in diesem Zusammenhang von einem eigentlichen Paradigmenwechsel sprechen: In Zukunft sind vorgenannte Abreden per se unzulässig und direkt sanktionierbar, sofern den Unternehmen nicht der – schwer zu erbringende – Nachweis gelingt, dass ihr Verhalten effizient ist. Damit hat das Bundesgericht mit seiner restriktiven Auslegung des Kartellgesetzes genau diejenige Gesetzesanpassung durch die Hintertür eingeführt, die das Schweizer Parlament erst vor kurzem abgelehnt hat. Einer der Hauptgründe für das Scheitern der Kartellrechtsrevision im Herbst 2014 war nämlich just der Vorschlag eines solchen Teilkartellverbots.
Während die heutige Schweizer Fusionskontrolle also weitgehend ohne Biss ist, gelten im Bereich der Abreden seit neuem äusserst harte Regeln. Dieser ohne Not geschaffene Widerspruch mindert die Kohärenz des Kartellrechts. Die ungleiche Behandlung von Abreden und Fusionen schafft ungewollte Anreize zur vertikalen Integration oder zur Gründung von «Joint Ventures» und beeinflusst somit die Organisationsform von Unternehmen. Ob dies wirklich dem Willen des Gesetzgebers entspricht, wie es das Bundesgericht jeweils so schön formuliert, darf angezweifelt werden.
Dieser Text ist am 4. Oktober 2017 als Gastkommentar in der Printausgabe der NZZ erschienen.