Ein wichtiges Merkmal der politischen Strukturen in Schweizer Metropolen ist die wachsende Kluft zwischen einer Classe politique, die sich weitgehend aus Einheimischen rekrutiert, und einer immer internationaler werdenden Stadtgesellschaft. Der Ausländeranteil in den zehn grössten Städten liegt zwischen 25% in Winterthur und 50% in Genf. Zählt man Eingebürgerte und Secondos hinzu, hat mindestens jeder Zweite einen Migrationshintergrund. In jüngeren Alterskohorten liegen diese Werte sogar noch höher. Auch die Wirtschaftsbasis der Stadt sowie Wissenschaft und Kultur sind zunehmend international orientiert.
Während sich die grossen Schweizer Städte somit zu Global Cities gewandelt haben, wird das politische Personal und die Verwaltung – aber auch die Wählerschaft – weiterhin von «Autochtonen» dominiert: In Basel ist der legendäre «Daig» noch immer eine politische Grösse, obwohl die Wirtschaft von multinationalen Unternehmen geprägt wird. Auch am Uno-Standort Genf sitzen noch Vertreter alteingesessener Familien an politischen Schaltstellen. Am Finanzplatz Zürich verdient man das Geld auf den Weltmärkten, während lokale Netzwerke in den Zünften geknüpft werden. Pointiert könnte man sagen, die politischen Rahmenbedingungen der Global City werden im Niederdorf ausgehandelt.

Die kleine Niederdorfoper widerspiegelt die Global City nicht mehr. (ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv)
Die geschlossene Gesellschaft der städtischen Politik begünstigt auch lokale Klientelpolitik. Klassisches Beispiel ist der hochpreisige urbane Wohnungsmarkt, auf dem subventionierte Wohnungen weit unter Marktwert über Mechanismen zugeteilt werden, die alteingesessene Insider bevorzugen. So gehört etwa in Zürich jede vierte Wohnung «gemeinnützigen» Genossenschaften oder der Stadt selber. Ein anderer wichtiger Anker sind die vielen Jobs in der Verwaltung, den städtischen Betrieben und in Institutionen, die in hohem Masse von städtischen Geldern abhängig sind (z.B. Kultur- oder Bildungseinrichtungen) und die vor allem dem Politmodell zugeneigte Stelleninteressenten anziehen.
Diese und andere Privilegien sind vor allem jenen zugänglich, die über lokales Wissen und Netzwerke verfügen bzw. langfristig in der Stadt leben. Dies sind meist auch jene, die wahlberechtigt sind und entsprechend Politiker wählen, die diese Privilegien erhalten und ausbauen. Durch diese, oft auch subtilen, politökonomischen Mechanismen sind in den grossen Schweizer Städten eigene politische «Biotope» entstanden, in denen eine Politik für städtische Insider gedeiht und die somit die eigene Wählerbasis verfestigt. Dies dürfte eine Erklärung dafür sein, dass sich das links-grüne Modell der Schweizer Stadtpolitik in den letzten Jahren derart verfestigen konnte – finanziert durch die eine städtische Sonderkonjunktur.
Eine Konsequenz dieser insiderorientierten Stadtpolitik ist die Tatsache, dass Neubau- und Verdichtungsprojekte häufig an den Einsprachen von Anwohnern scheitern, obwohl diese im Interesse der Stadt als Ganzes oder der neu Hinzuziehenden (Outsider) wären. Dies betrifft nicht nur konkrete Bauprojekte wie das Züricher Hardturmstadion, das nach erfolgreicher Intervention von Anwohnerverbänden 2018 zum dritten Mal neu aufgegleist werden musste. Es betrifft vor allem auch das formelle Regelwerk der Stadtplanung, wie die Zürcher Bau- und Zonenordnung, die in weiten Teilen der Innenstadt die Stadt als fertig gebaut betrachtet – entsprechend wurden Kernzonen massiv ausgeweitet, Aufstockungsmöglichkeiten sind hingegen nicht vorgesehen. Derartige Restriktionen laufen dem immer gerne proklamierten Ziel der Nachverdichtung entgegen. Auch wenn es dem Selbstverständnis des links-grünen Stadtmodells widerspricht, hat solche insiderorientierte Politik per Definition einen gewissen Hang zum Strukturkonservativismus.
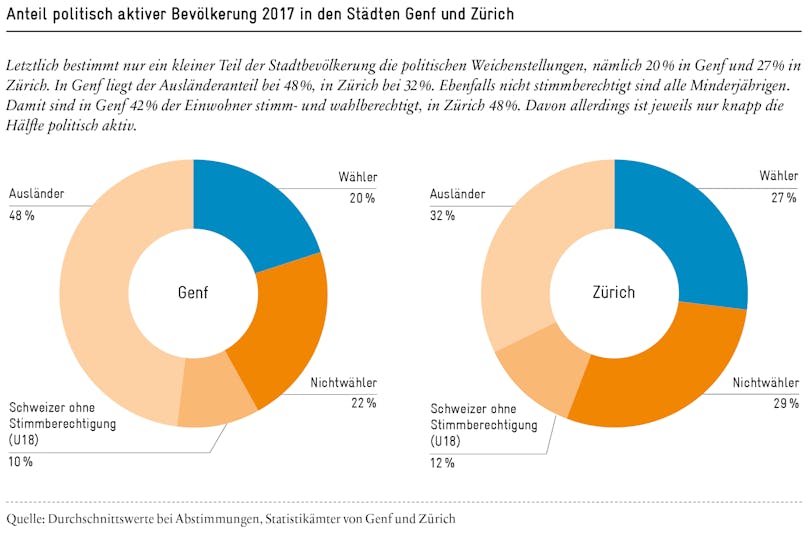
Weiterführende Informationen finden Sie in der Studie «20 Jahre Schweizer Stadtpolitik».







