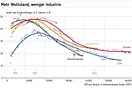Vielen ist die Situation bekannt, gerade in dieser Jahreszeit. Es steht ein wichtiger Termin bevor, doch ein paar Tage davor macht sich ein Kratzen im Hals bemerkbar. Dann, genau am wichtigen Tag, geht gar nichts mehr. Eine Lösung muss her. Mit verschiedenen Hausmittelchen und Medikamenten vollgepumpt, schafft man den Termin gerade noch – vielleicht sogar ganz gut. Aber am nächsten Tag ist Erholung angesagt, ansonsten droht eine langwierige Schwächung.
Eine Einbusse der Leistungsfähigkeit kurzfristig überbrücken ist auch in der Wirtschaftspolitik gang und gäbe. Dieses Prinzip hat niemand besser auf den Punkt gebracht als John Maynard Keynes. Laut ihm machen es sich Ökonomen zu einfach, wenn sie kurzfristigen Verwerfungen mit dem Argument begegnen, langfristig komme alles wieder ins Gleichgewicht. Einfach eine schwere Krise hinzunehmen und auf eine bessere Zukunft zu verweisen sei wenig hilfreich, denn, so schrieb er, «auf lange Sicht sind wir alle tot.»
Laut Keynes müssen Wirtschaftseinbrüche deshalb zeitnah mit Geld- und Fiskalpolitik gemildert werden. Sein Hauptwerk wurde während der Grossen Depression der 1930er Jahre publiziert. Die Argumentation fand unter Zeitgenossen entsprechend grossen Anklang. Doch nachdem eine erste Phase keynesianischer Wirtschaftspolitik in einer Wirtschaftsflaute mit hoher Inflation endete, ist der Ansatz in Verruf geraten. Das änderte sich vor 15 Jahren. Seitdem erleben die Ideen Keynes ein wahres Revival.
Die Ereignisse rund um die Finanzkrise 2008 weckten Erinnerungen an die Grosse Depression. Kein Wunder erinnerte sich die Welt in diesem Moment auch an Keynes – durchaus zu Recht. Ohne beherztes Eingreifen der Zentralbanken und Staaten drohte ein Kollaps. Um beim eingangs gewählten Bild zu bleiben: Vollgepumpt mit geldpolitischen Hausmittelchen und fiskalpolitischen Medikamenten konnte die Wirtschaft gerade noch am Laufen gehalten werden.

Geldpolitische Hausmittelchen und fiskalpolitische Medikamente helfen nur kurzfristig. (Kelly Sikkema, Unsplash)
Was jedoch bis heute fehlt, ist ein Absetzen der Medizin nach der akuten Systemkrise sowie ein Anpacken der zugrundeliegenden Probleme. Wie in der Vergangenheit stehen politökonomische Mechanismen im Weg. Die wirtschaftspolitischen Instrumente sind schlicht zu attraktiv. Einmal daran geschnuppert, geben Politiker den keynesianischen Nasenspray nicht mehr aus der Hand. Das hinterlässt über die Zeit Spuren.
Die Verschuldung diverser Staaten ist markant gestiegen, und viele dieser Schuldtitel liegen in den Büchern von Finanzinstitutionen. Gleichzeitig haben die Bilanzen der Zentralbanken ungekannte Grössen erreicht. Sie haben im Vergleich mit der Wirtschaftsleistung sogar die Werte aus den Weltkriegsjahren sowie früherer Kriege übertroffen.
Solche ökonomische Kennzahlen können wie medizinische Laborwerte gelesen werden. Sie deuten darauf hin, dass der allgemeine Gesamtzustand nach und nach kritischer geworden ist. Der Einsatz von Medikamenten hat dem Patienten zwar erlaubt, eine Krise zu überstehen, aber eben auch, die Ursachen der Probleme nicht anpacken zu müssen. In der Folge wird das permanente kurzfristige Aufpeppen mit einer langfristigen Schwächung bezahlt.
Die Fragilität wurde in diesem Jahr sichtbarer, als zuerst die Inflation und im Nachzug die Zinsen angezogen haben. Im Frühjahr sind verschiedene US-Banken nach Verlusten auf den von ihnen gehaltenen Staatspapieren in Schieflage geraten. Und vergangene Woche hat derselbe Effekt dazu geführt, dass eine erste Zentralbank ein negatives Eigenkapital kommunizieren musste: Die Riksbank hat beim schwedischen Parlament in der Folge um eine Kapitalerhöhung ersucht.
Damit zeigt sich einmal mehr das Problem keynesianischer Wirtschaftspolitik: Sie wirkt kurzfristig in Theorie und Praxis, ist langfristig aber nur in der Theorie nachhaltig. Das ist eine gefährliche Mischung. Rasch verstetigt sich die Symptombekämpfung, mit negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. «Auf lange Sicht sind wir alle tot» bekommt dann eine zynische Bedeutung – eine, die viele fälschlicherweise auch Keynes zuschreiben: Was kümmern mich Probleme in der Zukunft, Hauptsache mir geht es heute gut.
Eine solche Einstellung endet über kurz oder lang im Desaster. Es ist der Grund, weshalb viele Ökonomen seit Jahren zu Recht auf strukturelle Reformen im Finanz- und Staatssektor pochen. Was unpopulär ist und technokratisch klingt, ist im Grunde genommen intuitiv: Jeder weiss, dass man sich permanent verschnupft eine gewisse Zeit mit Medikamenten über Wasser halten kann. Doch am Ende ist Bettruhe und ein Anpassen des allgemeinen Lebensstils notwendig. Bleibt das aus, kommt die lange Sicht schneller, als einem lieb ist.
Dieser Text wurde als erster Beitrag einer neuen, monatlich erscheinenden Kolumne von Jürg Müller in der «NZZ am Sonntag» publiziert.