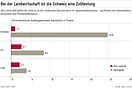Die diesjährige Herbsttagung galt den Auswirkungen der unorthodoxen Geldpolitik. Eröffnet wurde sie mit der Feststellung von Avenir-Suisse-Direktor Gerhard Schwarz, dass Geld die Welt regiert. Doch wer regiert das Geld? Und was sind die Folgen?
Mit William R. White, ehemaliger Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und frühzeitiger Warner vor den Risiken einer ultralockeren Geldpolitik, Leszek Balcerowicz, der als Finanzminister und Notenbankchef den erfolgreichen Transformationsprozess Polens von der Kommando- zur Marktwirtschaft massgeblich mitgestaltet hat und Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB), referierten und diskutierten drei Persönlichkeiten, die eng mit der Geldpolitik verbunden sind.
Kein Liquiditäts-, sondern ein Schuldenproblem
William White ging mit der ultraexpansiven Geldpolitik der Zentralbanken hart ins Gericht. Sie beruhe auf falschen Annahmen. Die Weltwirtschaft leide nicht an einem Liquiditäts-, sondern an einem Solvenzproblem. Letzteres müsse politisch gelöst werden. Doch leider versteckten sich die Politiker hinter den für die Bewältigung von Liquiditätsproblemen zuständigen Zentralbanken und bürdeten diesen Aufgaben auf, die sie nicht erfüllen könnten.
So sei es kein Wunder, dass die mit der ultraexpansiven Geldpolitik angestrebte Nachfragestimulierung nicht gelungen ist. «Die ultratiefen Zinsen verunsichern die Wirtschaft und vermitteln den Eindruck von Panik». Als Folge des Quantitative Easing drohe «financial repression», inkl. dem Zwang, sein Geld in Staatspapiere anzulegen – keine guten Voraussetzungen für Unternehmensinvestitionen. Zudem werde der private Verbrauch durch die steigende Verschuldung der Haushalte gebremst. Tatsächlich stieg die globale Verschuldungsquote seit 2007 um 20 %. Von Schuldenabbau also keine Spur. Nach wie vor würden Zombiebanken Zombieunternehmen finanzieren, gleichzeitig stiegen die Preise vieler Aktiven auf korrekturanfällige Niveaus.
Erschwerend komme hinzu, dass alle weltwirtschaftlich bedeutenden Regionen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten: In den Vereinigten Staaten sei die Sparquote zu niedrig, die Euro-Zone sei mit Strukturproblemen beschäftigt. Die aufstrebenden Volkswirtschaften, die bis vor kurzem eine relativ geringe Verschuldung und ein hohes Wachstumspotenzial aufwiesen und damit Teil der Lösung hätten sein können, seien Teil des Problems geworden. Sie steckten vor allem wegen der stark gestiegenen Schuldenlast ihrer Unternehmen in Schwierigkeiten.
Der Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik werde umso schwieriger, je später die Zentralbanken die Fesseln der Politik abwürfen. Damit stellt sich die Frage nach den Perspektiven. Ein positiver Ausgang der gegenwärtigen Krise sei nicht ausgeschlossen – aber gemäss White ist die Wahrscheinlichkeit eines turbulenten Endspiels mit gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft grösser.
Staatlicher Interventionismus als Krisenursache
Kaum mehr Optimismus verbreitete Leszek Balcerowicz, der heute als Professor an der Warsaw School of Economics tätig ist. Er sieht die Hauptursache für die Finanz- und Schuldenkrise nicht im Marktsystem, sondern im zunehmenden staatlichen Interventionismus, der letztlich zu einer wirtschaftlichen und sozialen Destabilisierung führe. Er belegte dies mit «sozialistischen Enklaven» wie Fannie Mae und Freddie Mac in den USA, die Länderbanken in Deutschland und die Cajas in Spanien. Es sei grotesk, dass Krisen dem Kapitalismus in die Schuhe geschoben würden, obwohl die grössten Wachstumseinbrüche in sozialistischen Autokratien erfolgten. Schlechte Wirtschaftspolitik sei meist das Resultat von schlechter Regulierung, z.B des überdimensionierten Regelwerks von Basel. Die zentrale Frage laute deshalb: Wie kann man schlechte Wirtschaftspolitik vermeiden? Die Antwort von Balcerowicz ist klar und einfach: «Je besser es gelingt, die Politik von den Schalthebeln der Wirtschaft fernzuhalten, desto besser sind die Wachstumsbedingungen.»
Für die EU bzw. die Eurozone zeigte er sich wenig zuversichtlich. Zum einen sei die unorthodoxe Geldpolitik der EZB weder ein «free lunch», noch könne sie fiskalische und strukturelle Reformen ersetzen. Zum andern seien «Top-down»-Reformen für Europa keine Lösung, weil sich die Länder bezüglich Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum zu sehr unterscheiden. Die Strukturprobleme Frankreichs oder Italiens könnten nicht mit einer Fiskalunion gelöst werden. Die einzig positiven Beispiele einer Fiskalunion sind für Balcerowicz Australien, die USA und die Schweiz, dank verfassungsrechtlich verankerten «no-bail-out»-Klauseln.
Verhalten positiver Ausblick
Nach den gedämpften Ausblicken der Vorredner oblag es Thomas Jordan, wenigstens etwas Hoffnung aufkommen zu lassen. Ausgangspunkt seiner Ausführungen war der Vergleich einiger wichtiger Eckwerte zu Beginn der Finanzkrise 2007 mit jenen von heute.
| Oktober 2007 | Oktober 2015 | |
| Zielwert Dreimonats-Libor | 2,75% | – 0.75% |
| Giroguthaben der Banken | 5 Mrd. Fr. | 399 Mrd. Fr. (per 2. Oktober) |
| SNB Bilanz in % des BIP | rund 20% | rund 90% |
| Inflation | 1.3% | – 1,4% (September) |
Für die SNB präsentierte sich die Situation zu Beginn des Jahres 2015, als sie den Mindestkurs aufhob, völlig anders als vor der Einführung des Euro-Mindestkurses im September 2011. Damals bestand ein Problem einer Frankenstärke, 2015 hingegen eines einer Euroschwäche als Folge der anhaltenden Staatsschuldenkrise, der Wirren um Griechenland und der angekündigten quantitativen Lockerung der Geldpolitik der EZB. Unter diesen Umständen wäre die Fortführung der Mindestkurspolitik nicht mehr nachhaltig gewesen. Die SNB hätte den Mindestkurs permanent mit Interventionen verteidigen müssen, womit nicht nur die Kontrolle über die Bilanz, sondern letztlich auch über die Geldpolitik verloren gegangen wäre. Die SNB handelte, als sie noch Handlungsfreiheit hatte. Besonderen Wert legte Jordan auf die Feststellung, dass die SNB nie vor einer Ausweitung der Bilanz zurückgeschreckt sei, aber dass der Nutzen der Bilanzausweitung dabei die Kosten übersteigen müsse. Er sei sich bewusst, dass die Aufhebung des Mindestkurses für weite Teile der Wirtschaft eine grosse Herausforderung darstelle und sowohl in den Bilanzen wie auch in der Konjunktur Spuren hinterlasse. Doch im Unterschied zu 2011 sei der Franken heute nicht mehr gegenüber allen wichtigen Währungen gleich stark überbewertet.
Jordan anerkannte, dass Negativzinsen ein ungewöhnliches Instrument mit potenziellen Nebenwirkungen sind: Längerfristig könnten tiefe und negative Zinsen die volkswirtschaftliche Ressourcenallokation verzerren und insbesondere zu Hauspreissteigerungen und schnellerem Kreditwachstum führen. Die Negativzinsen seien aber in der aktuellen Situation – neben der Interventionsbereitschaft – ein wichtiges und unverzichtbares geldpolitisches Instrument, um die Attraktivität des Frankens zu schwächen. Die potenziellen negativen Auswirkungen der seit 2008 tiefen Zinsen hielten sich zudem in Grenzen. Dank der Selbstregulierungsmassnahmen der Banken und dem antizyklischen Kapitalpuffer sei die Lage auf den Immobilienmärkten grösstenteils unter Kontrolle. Es sei zurzeit auch eine Entschleunigung des Kreditwachstums zu beobachten. Von den Negativzinsen seien zudem nur je maximal 5% der Aktiven des Bankensystems und der Pensionskassen betroffen.
Jordan konzedierte, dass eine leicht positive Inflation volkswirtschaftlich zwar besser wäre, doch sei die derzeitige negative Teuerungsrate Teil des Anpassungsprozesses nach der Frankenaufwertung. Wichtig sei, dass die Wirtschaft die Lohnstückkosten relativ zu den ausländischen Konkurrenten unter Kontrolle halte. Jordan attestierte der Schweizer Wirtschaft eine erstaunliche Widerstandskraft, da das Wachstum nach einem leicht negativen ersten Quartal im zweiten Quartal bereits wieder leicht zugelegt habe.
Abschliessend erinnerte Jordan daran, dass die SNB das komplexe internationale Umfeld der Finanzmärkte nicht beeinflussen könne. Sie müsse monetäre Bedingungen schaffen, die mittelfristig die Erfüllung des verfassungsmässigen Auftrags ermöglichten – temporär suboptimale Inflation sei leider nicht immer ganz vermeidbar.
Keine Frage der Perspektive
Skepsis gegenüber der aktuellen Geldpolitik der Zentralbanken prägte die abschliessende Diskussion mit dem Plenum: Das grösste Risiko von negativen Teuerungsraten seien die höheren Kosten für die Unternehmen. Diese bremsten die Investitionen, weil die nominellen Löhne nach unten wenig flexibel seien. Die ultra-expansive Geldpolitik hingegen schürt auch Sorgen der anderen Art: Befürchtet wird, dass diese längerfristig zu Inflation führt, analog der Entwicklung in den 60er/70er Jahren.
Die Frage, ob Negativzinsen mit einem marktwirtschaftlichen System vereinbar sind, wurde nicht wissenschaftlich, sondern pragmatisch beantwortet. Grundsätzlich seien sie ein Fremdkörper im Arsenal der Zentralbanken, in der heutigen aussergewöhnlichen Situation aber ein notwendiges Übel. Insgesamt überwog der Eindruck, dass zur Lösung kurzfristiger Probleme zu leichtfertig gravierende längerfristige Verzerrungen in Kauf genommen werden – ob aus globaler, europäischer oder schweizerischer Perspektive.