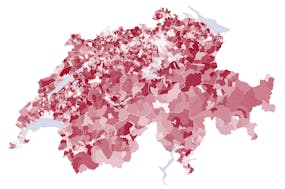Rund 15 Milliarden Franken pandemiebedingte Zusatzausgaben notierten die Bundesfinanzbuchhalter für das vergangene Jahr. Dazu kommen eingegangene Verpflichtungen mit Bürgschaften und Garantien von 17,5 Milliarden. Und für die ersten vier Monate im laufenden Jahr sind nochmals fast 24 Milliarden Franken Ausgaben bewilligt worden.
Längst nehmen nicht nur die vom Lockdown-Bann arg gebeutelten Gastwirtschafts- und Hotelleriebetriebe, Detailhändler und Reisebüros die staatlichen Finanzhilfen in Anspruch, unter den Top-Ten der Härtefallbezüger von A-fonds-perdu-Beiträgen finden sich auch Unternehmensberater oder Futtermittelproduzenten. Die Staatsquote dürfte sich gemäss den aktuellen Prognosen der eidgenössischen Finanzstatistiker im laufenden Jahr auf fast 37 Prozent des BIP erhöhen, d.h. satte 5,5 Prozentpunkte über dem Vorkrisenzustand.
Doch damit nicht genug: In parlamentarischen Marathondebatten wird um weitere Ausgabenpositionen gerungen. Dabei werden sie von der forschenden Ökonomenzunft sekundiert, wie jüngst eine Umfrage des Konjunkturforschungszentrum der ETH und der NZZ ergab. Für die Hälfte der befragten Ökonomen, vorab im Solde von staatlichen Universitäten stehend, hätten die Finanzhilfen sogar noch grösser ausfallen dürfen. Die neu geäufneten Schulden von rund 30 Milliarden Franken werden unter Ausblendung realpolitischer Zwänge als nicht gravierend eingeschätzt. Dem liegt auch der theoretische (Irr-)Glaube zu Grunde, dass Inflation und Zinsen auf Jahrzehnte hinaus auf niedrigem Niveau verharren werden. Doch es gilt auch hier Milton Friedman: «Vor Schulden, die man gemacht hat, auch Staatsschulden, kann man nur eine Zeitlang davonlaufen, eingeholt wird man schliesslich doch.»
Finanzminister Ueli Maurer warnte denn auch jüngst von einem Ausgabenrausch. Der Schweizer Tourismus verlangt dennoch zusätzliche drei Milliarden vom Bund für die Nach-Corona-Zeit. Wenn der Bund schon Geld für die Bauern ausgebe, könne er auch den Tourismus unterstützen, so die durchschlagende Finanzlogik der Tourismuslobbyisten. Und auch die Sozialdemokratie möchte im Verbund mit den Grünen grosszügig weitere Steuergelder für staatliche Impulsprogramme aufwenden. Sie blenden konsequent aus, dass solche zu Strukturerhalt, Marktverzerrungen und neuer Staatsverschuldung führen. Vor allem wäre die Auswirkung für die heute von der Krise Betroffenen höchst bescheiden: Was sollte beispielsweise ein klimaneutrale Fotovoltaik-Grossanlage – dessen Planung, Konzeption und Bau Jahre dauern würde – den derzeit in Kurzarbeit stehenden Angestellten in der Gastro- oder Eventbranche nützen?
Zu Recht hat der Staat zu Beginn der Pandemie auf die drei Instrumente Kurzarbeit, Erwerbsersatz und Bürgschaften für Überbrückungskredite gesetzt. Es galt, in einer Ausnahmesituation die Gefahr von makroökonomischen Kettenreaktionen zu vermeiden. Dennoch wurden bereits früh im ganzen politischen Spektrum zusätzliche öffentliche Unterstützungen gefordert. Anstatt den Fokus auf die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt zu legen, wurde zunehmend Branchenförderung betrieben. In der Hitze des Gefechts ergriff man auch finanzielle Massnahmen, die weit über das Ziel hinausschossen.

Die staatlichen Finanzhilfen wirkten rasch, es waren sozusagen wirksame Opiate, welche die grossen Schmerzen eines abrupten Herunterfahrens der Wirtschaft stark milderten. (Nastya Dulhiier, Unsplash)
Ein klares Indiz dafür ist die sinkende Zahl der Konkurse im vergangenen Jahr. Diese liegt deutlich unter dem Durchschnitt, auch im Vergleich mit früheren Krisen. Durch die milliardenschweren Finanzhilfen wurden Teile der Wirtschaft über Monate hinaus «eingefroren». Dies verunmöglichte eine «schöpferische Zerstörung», wie sie der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter einst proklamierte – gemeint ist die Weiterentwicklung der Wirtschaft selbst in Krisenzeiten mit immer neuen Innovationsschüben.
Die Pandemiebekämpfung machte zugleich gravierende Mängel im staatlichen Krisenmanagement offenkundig. Die Fehlerliste ist lang: Überstürzte Grenzschliessungen und fehlende internationale Kooperation, Unvermögen bei der Maskenbeschaffung, willkürliche Quarantäneregeln, ein wenig wirksames Tracing-App, die digitale Dysfunktionalität bei der Impfregistrierung, die verzögerte Bereitstellung von Vakzinen und des digitalen Impfpasses, bürokratische Hindernisse bei Selbsttests. Diese Aufzählung ist keinesfalls abschliessend.
Den grössten Beitrag zur Überwindung der Pandemie, nämlich die Entwicklung von wirksamen Impfstoffen, leistete hingegen die Privatwirtschaft. Die unternehmerische Innovationskraft bleibt hoch: Aus einem Veterinärmedizin-Diagnostik-Startup in Bern wird ein neues Unternehmen für Covid-Schnelltests, Schnapsbrennereien in der Innerschweiz stellen in Rekordzeit ihre Anlagen auf die Produktion von Desinfektionsmitteln um.
Angesichts des unzweideutigen Staatsversagens gehört es ins Kapitel der jungsozialistischen Utopie, auf eine anhaltend dirigistische Einflussnahme des Staates auf das private Wirtschaftsgeschehen zu spekulieren. Auch wenn politisch linke Kräfte über die Zunahme des Staatseinflusses in den vergangenen 14 Monate öffentlich frohlocken, die Tendenz zur «Verstaatlichung» wird nicht irreversibel sein. Das Mantra, wonach jedes Unternehmen gerettet und jedes Einzelschicksal zu berücksichtigen sei, verfängt beim Steuerzahlenden – und damit beim Bürger – auf Dauer nicht.
Unverständnis rufen bei der Allgemeinheit und bei den Wirtschaftsverantwortlichen hingegen die anhaltenden Einschränkungen, die bürokratischen und teilweise realitätsfremden Regulierungen im Namen der Gesundheitsprävention hervor. Findet eine Trendumkehr statt, weg vom Staatsglauben hin zu mehr Staatskritik? Die Zeiten sind jedenfalls vorbei, als die ganze Schweiz am Mittwochnachmittag vor dem Fernsehbildschirm sass und gebannt den bundesrätlichen Ausführungen zur Pandemiebekämpfung folgte.
Das traditionell obrigkeitskritische helvetische Gemüt (Corona-Leugner explizit ausgenommen!) fordert allenthalben das Wiederlangen von wirtschaftlichen und individuellen Freiheiten. Diese Forderung findet auch unter der Bundeshauskuppel zunehmend Widerhall. Dazu trägt die sich entspannende Corona-Lage bei. Mit der Lockerung der Pandemiemassnahmen dürfte es auch zu einer zügigen Erholung der Wirtschaft kommen. Erwartet wird ein BIP-Wachstum von rund drei Prozent in diesem Jahr. Damit einhergehen muss aber zwingend eine Wiederherstellung der liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Auch wenn das Loslassen vom dirigistischen administrativen Klein-Klein manch einem Bundesrat nicht leichtfallen wird: Das Festlegen der Anzahl Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde entspricht nicht dem Grundsatz einer effizienten und effektiven Wirtschaftspolitik.
Die staatlichen Finanzhilfen wirkten rasch, es waren sozusagen wirksame Opiate, welche die grossen Schmerzen eines abrupten Herunterfahrens der Wirtschaft stark milderten. Doch Opiate sind und bleiben süchtig machende Drogen. Mit der Normalisierung der Lage ist deshalb ein schneller Entzug nötig. Ansonsten drohen Zerfallserscheinungen. Der Schuldenabbau ist zügig an die Hand zu nehmen – primär durch eine Senkung der Ausgaben für den öffentlichen Sektor. Wer den Schuldenabbau ad infinitum strecken will, blendet aus, dass sogenannte «Jahrhundertkrisen» im 10-Jahresrhythmus zu meistern sind.
Die Rückkehr zu einer liberalen Wirtschaftsordnung mit und nach Covid-19 verlangt, den wirtschaftlichen Strukturwandel (wieder) zu ermöglichen, der spezifischen Branchenförderung konsequent zu entsagen und dem Wettbewerbsprinzip wieder verstärkt zu folgen – dank offenen Märkten (auch gegenüber der EU!). Avenir Suisse widersetzt sich dem Hochziehen neuer Grenzzäune und spricht sich auf allen Ebenen für Marktpreise statt der Ausschüttung von zusätzlichen Subventionen aus. Auch sollte – nicht nur in der Klimapolitik – das Verursacherprinzip und die Kostenwahrheit gelten. Die Wiederherstellung von liberalen Rahmenbedingungen mit einem ausgeglichenen Staatshaushalt, einer niedrigen Staatsquote, einer überschaubaren Regulierung, Rechtssicherheit und umfassender Eigentumsgarantie bleibt das beste Rezept zur nachhaltigen Gesundung unseres Landes nach dieser Pandemiekrise. Die Drogen müssen wieder im Giftschrank verschwinden.
*Dieser Wochenkommentar basiert auf dem Referat von Peter Grünenfelder anlässlich des digital durchgeführten Annual Dinner von Avenir Suisse vom 18. Mai 2021.