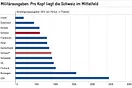Ich teile den Befund, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise notwendigerweise von einer Wertekrise gefolgt wird, nicht ganz. Vielleicht ist es eher so, dass die Wertekrise der Finanzkrise voranging, sie bedingte. Wir haben in der Tat eine dramatische Situation bei denjenigen, die Werte bisher verteidigt und konserviert haben: bei den Kirchen, den politischen Parteien, beim Bildungsbürgertum. Hier sieht man entweder nur noch wenig Bereitschaft, sich zu engagieren, oder aber wenig Glaubwürdigkeit, wenn es um Werte geht.
Zu grosse soziale Unterschiede
Die Finanzkrise und die Anstrengungen, sie zu bewältigen, haben allerdings ein Grundprinzip des abendländischen Staatsverständnisses ausser Kraft gesetzt: dass in einem demokratischen Staat die Starken für die Schwachen einstehen. Hier war es umgekehrt. Die Schwachen haben die Risiken tragen müssen, die die Starken eingegangen sind. Das hat vielfach zu einem Nachdenken darüber geführt, ob die Gegenseitigkeit, auf der das Verhältnis von Bürgern zu ihrem Staat beruht, tatsächlich noch besteht. Dass es in einigen Ländern nicht beim Nachdenken geblieben ist, war in den Ländern Europas in den vergangenen Monaten auf der Strasse zu erleben. Dennoch ist ein breites Bewusstsein dafür geblieben, dass man zu grosse soziale Unterschiede ablehnt und Ausgleichsmechanismen befürwortet; dass eine Gesellschaft nur dann als gerecht gelten kann, wenn sie allen die Chance gibt, sich zu bilden, sich zu beteiligen, aufzusteigen; dass ein Staat nur dann als stabil gelten kann, wenn er seinen Bürgern für ihre Loyalität etwas gibt.
Der demokratische Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann – dieses Wort des Staatsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde gilt heute mehr denn je. Denn diejenigen, die diese Voraussetzungen bisher als Begleiterscheinung zu ihrem Kerngeschäft mitgeliefert haben (vor allem die Kirchen), können das heute nicht mehr. Die Säkularisierung des Lebens, der rasante Wertewandel, die Glaubwürdigkeitskrise der Kirchen: All diese Erscheinungen wirken gemeinsam und einander verstärkend.
Ehrenamtliches Engagement
Wenn es um die Institutionen geht, müssen die Politik und die Kirchen daran arbeiten, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Das wird aller Voraussicht nach aber nicht dazu führen, dass sie ihre alte Deutungshoheit über die ethische und moralische Qualität menschlichen Handelns zurückgewinnen. Das Bildungsbürgertum wird hier zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte in die Pflicht genommen. Ich sehe nicht, warum es nicht gelingen sollte: Gebildete müssen vielleicht mehr als alle anderen daran ein Interesse haben, dass Staat und Gesellschaft funktionieren, dass der Staat seinen Teil des Gesellschaftsvertrages dauerhaft erfüllen kann. Deshalb müssen sie liefern (und oft wollen sie das auch) – und nicht nur, indem sie sich gesetzestreu verhalten, ihre Steuern zahlen und ihre wenigen Kinder anständig erziehen. Wenn man sich einmal ansieht, wer sich in den hochentwickelten westlichen Gesellschaften ehrenamtlich engagiert, dann sieht man, dass überall ein solches Bewusstsein wächst. Das wird gern unter dem Stichwort «der Gesellschaft etwas zurückgeben» zusammengefasst. Das würde nichts anderes formulieren, als dass es darum geht, einen erlebten Vorteil abzugelten. Doch es ist viel mehr. Es ist eine Investition in eine stabile gesellschaftliche Situation, von der die Mittel- und Oberschicht derzeit am meisten profitiert und das wohl auch in Zukunft tun wird. Es gibt also viele gute Gründe, sich für eine Wertegemeinschaft zu engagieren.
Natürlich ist eine Gesellschaft immer starken Spannungen ausgesetzt, wenn sie sich selbst vorübergehend nicht auf einen gemeinsamen Wertekanon verständigen kann. Wenn dieser Zustand andauert, und wenn er auf der anderen Seite begleitet wird von einem Verzicht auf das staatliche Gewaltmonopol, dann wird das Gemeinwesen zerfallen. Aber sind wir schon so weit, oder kommen wir unausweichlich dahin? Wenn man sich die Protestbewegungen in Europa anschaut, die Steuermoral in einzelnen Ländern, die Auseinandersetzungen zwischen den grossen politischen Blöcken in den Vereinigten Staaten von Amerika, dann könnte man auf diesen Gedanken kommen. Doch glaube ich, dass Wertebezüge am Ende robuster sind, als es im Augenblick den Anschein hat.
Keine Angst vor dem Wettbewerb
Allerdings: Wir leben in einer Zeit, in der unterschiedliche Wertvorstellungen in offene Konkurrenz treten. Das sehen wir gerade in internationalen Konzernen, aber auch in der Weltwirtschaft als Ganzes. Während im abendländisch geprägten Wirtschaftssystem Korruption als Verstoss gegen Gesetze und gute Sitten gilt, gehören Provisionen und Gefälligkeiten in weiten Teilen der asiatischen oder arabischen Welt immer noch zum akzeptierten Kanon alltäglichen Geschäftsgebarens. Geistiges Eigentum ist eine andere Erfindung des Abendlandes, dessen Schutz in Asien nicht überall denselben Respekt geniesst wie in den hochentwickelten Volkswirtschaften des Westens. Oder nehmen wir die Gier: In humanistisch und christlich geprägten Gesellschaften gilt sie als eine der Todsünden, der die Mässigung als Kardinaltugend gegenüber gestellt wird. In Teilen Asiens dagegen wird ein dynamisch wachsender persönlicher Reichtum, der gerne auch zur Schau gestellt werden darf, als Ausweis der besonderen Tüchtigkeit und des ausserordentlichen Glücks des Reichen begriffen. Es sind also nicht nur die Konventionen, die sich immer ändern und anpassen. Es sind die Grundpfeiler des westlichen Wertsystems, die Konkurrenz bekommen haben. Dass sie in diesem Wettbewerb unausweichlich unterliegen müssen, scheint mir nicht ausgemacht zu sein. Warum auch?
Dieser Text von Ursula Weidenfeld stammt aus dem Buch «Der Wert der Werte», das bereits in zweiter Auflage vorliegt.