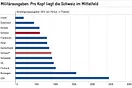«influence»: Sie sind neuer Direktor des Think-Tank Avenir Suisse. Welche Bedeutung hat für Sie die Schweiz?
Peter Grünenfelder: Die Schweiz ist meine Heimat, wo ich lebe, arbeite, meine Freunde mehrheitlich wohnen und meine Schweizer Familienwurzeln sind. Für mich ist unser Land eine liberale und damit wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, für die es sich immer wieder einzusetzen gilt, um den Wohlstand für breite Bevölkerungskreise auch in Zukunft sicherzustellen.
Wenn Sie ins Ausland reisen, worauf sind Sie besonders stolz?
Unser Land hat sich seit der Gründung der modernen Schweiz im Jahre 1848 vom Armenhaus zum wirtschaftlichen Erfolgsmodell entwickelt – noch 1850 waren die Niederlande und Grossbritannien doppelt so reich wie wir, bereits nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir aber das zweithöchste Bruttosozialprodukt weltweit. Der Wohlstand und der Reichtum unseres Landes wurden neben dem hohen Arbeitsethos unserer Bevölkerung insbesondere durch frühe Internationalisierung und Zuwanderung geschaffen – etwa durch die Hugenotten in der Uhrenindustrie. Diese fruchtbare, kreative und letztlich erfolgreiche Mischung ist eine grossartige Errungenschaft. Sie bildet das Fundament des Zusammenhalts und der Kohäsion – und weniger die Legenden um Wilhelm Tell.
Die Schweiz hatte aber auch Glück, dass sie von den Weltkriegen verschont blieb.
Der Wohlstandserfolg der Schweiz hängt tatsächlich auch vom Glück ab. Das beginnt schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die monarchischen Regimes, die uns umgaben, hatten Interesse an der Schweiz als einer neutralen Pufferzone zwischen den Grossmächten. Sie liessen uns gewähren. Und die Schweiz nutzte die Gelegenheit und gab sich die ausgewogene Verfassung von 1848. Sie ist durchdrungen vom Ausgleich der Interessen und von einer gesunden Skepsis gegenüber den Eliten. Das ist bis heute geblieben: Die Schweizer hinterfragen alles kritisch.
Welches sind die Erfolgsfaktoren der Schweiz?
Es braucht ein erfolgreiches, auch global ausgerichtetes Unternehmertum und gut ausgebildete Arbeitskräfte. Zentral sind ferner ein liberaler Arbeitsmarkt, eine aussenwirtschaftspolitische Offenheit, eine schlanke, aber effiziente Staatstätigkeit mit moderaten Steuern, stabile Staatshaushalte in Bund und Kantonen sowie keine überbordende Regulierung. Dazu haben wir den föderalistischen Systemwettbewerb zwischen den Kantonen. Zur Prosperität tragen auch eine stabile politische Situation und damit Rechts- und Investitionssicherheit bei. Zu beobachten sind aber eine starke Zunahme an marktfeindlichen Volksinitiativen wie 1:12, Mindestlohn und aktuell das bedingungslose Grundeinkommen. Dazu haben wir teilweise knappe Mehrheiten an Volksabstimmungen, bisweilen fast Zufallsentscheide. Dies kann für Unsicherheit sorgen, nicht zuletzt bei den Investoren.
Was macht die Schweiz aus? Was ist das Besondere, das Einzigartige?
Wir haben ein fein austariertes System der Meinungsbildung und des Minderheitenschutzes. Darin spiegelt sich auch die Stärke und Autonomie der Kantone, was dazu führt, dass ausländische Besucher häufig gar nicht wissen, wer die Schweiz eigentlich regiert. Bundesrat und Bundesversammlung spielen eine bedeutende Rolle, die Kantone selbstredend auch, das Volk kann in wichtigen Belangen mitentscheiden. Dazu kommt eine unabhängige Gerichtsbarkeit. Das System der Meinungsfindung ist von aussen bisweilen schwer zu verstehen, ist aber eine Stärke der Schweiz. Die grossen Entscheide werden von vielen Köpfen und Institutionen getragen. Sie sind nicht von einer einzigen Person oder einer kleinen Gruppierung abhängig.
Hemmt das lange Austarieren, diese zum Teil mühsame Entscheidungsfindung nicht die Entwicklung der Schweiz?
Die Schweiz kommt nie durch Revolutionen weiter, sondern nur durch Evolutionen. Ein Beispiel ist das Frauenstimmrecht oder der Uno-Beitritt. Es braucht Zeit und einen Lernprozess, bis das Land sich zu einem Entscheid durchringt.
Wie wichtig ist die direkte Demokratie?
Sie ist Teil der Schweizer Identität, und das ist gut so. Das Volk ist aber nicht per se abschliessend für alles zuständig. Eigentlich haben wir ja eine halb-direkte Demokratie. Das Dreieck zwischen der Politik, der Judikative und dem Souverän ist ein sensitives Machtgefüge. Wir haben in letzter Zeit den «Volkswillen» etwas gar emporstilisiert. Das Dreieck sollte im Gleichgewicht bleiben.
Wie steht es um den Föderalismus?
Er ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Föderalismus treibt den Wettbewerb der Systeme respektive der Kantone und der Gemeinden an. Die heutige 4-Säulen-Drogenpolitik zum Beispiel wurde in den 1990er-Jahren in der Stadt Zürich entwickelt und nicht etwa von oben, von der Bundespolitik, dekretiert. Frühenglisch wurde im Appenzell erstmals in den Schulen eingeführt. Der Föderalismus dient dem permanenten Leistungsvergleich und animiert die Kantone und Gemeinden, noch besser zu werden. Diese Philosophie darf nicht verwässert werden. Es braucht in der Schweiz den Wettbewerb der Systeme, etwa im Steuer- oder im Bildungsbereich.
Gleichzeitig nimmt das Engagement der Bevölkerung für politische Ämter ab. Die Freiwilligenarbeit ist seit Jahren rückläufig, was nicht gerade für die Attraktivität des Staates und der Verwaltung spricht.
Das ist einerseits ein weitverbreitetes Phänomen – die Leute sind weniger bereit, sich über einen längeren Zeitraum für Milizämter zur Verfügung zu stellen. Andererseits widerspiegelt dies die Internationalisierung der hiesigen Unternehmen. Wir müssen daher Verständnis für das schweizerische System schaffen, das auf Freiwilligenarbeit und Ehrenamtlichkeit beruht. Dafür gibt es zwei Lösungsansätze: Aufklärung mit Betonung der Bedeutung der Miliztätigkeit für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Zugleich den gut integrierten Zuzügern eine Mitwirkung ermöglichen, etwa durch die Einführung des Ausländerstimm- und Wahlrechts auf Gemeindeebene.
Wie bitte?
Absolut. Auf der einen Seite brauchen wir die ausländischen Fachkräfte, weil sie wichtige Stützen unseres wirtschaftlichen Erfolgs sind. Auf der anderen Seite geben wir ihnen keine Möglichkeit, mitzuwirken und mitzubestimmen. Da müssen wir uns öffnen – gerade auf kommunaler Ebene. Auch Bürger ohne Schweizer Pass sollen die Möglichkeit haben, sich in unserem Gemeinwesen einzubringen und auf diese Weise zum politischen und gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Gleichzeitig müssen wir den Unternehmen klar machen, dass eine politische Miliztätigkeit eines Mitarbeiters auch dazu beträgt, Verständnis für die Anliegen des Unternehmerischen in die politischen Entscheidungsprozesse hineinzutragen.
Weshalb?
Der wirtschaftliche Erfolg sowie das gegenseitige Verständnis für das Funktionieren von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft halten unser Land zusammen. Deshalb werden und müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, welches die Wohlstands-generierenden Faktoren in der Schweiz sind.
Was heisst das für die staatliche Investitionstätigkeit?
Steuergelder sollten vornehmlich in Exzellenz, etwa in Bildung und Forschung, investiert werden, um die Innovationskraft des Landes zu erhalten und zu stärken. Innovationssprünge tragen in der Regel zu weiterem Wirtschaftswachstum und damit auch zu zusätzlicher Prosperität bei. Das Postulat für Investitionen in Exzellenz bedeutet gleichzeitig das kritische Hinterfragen der gegenwärtigen Subventionen in wenig produktive Branchen wie etwa im Agrarbereich. Wir müssen uns die Erfolgspfeiler der Schweiz vor Augen halten. Wenn man zehn Jahre in die Zukunft blickt, muss man heute schon die Weichen stellen und wichtige Probleme angehen. Doch man verschliesst oft die Augen. In der Aussenwirtschaftspolitik etwa dominiert die emotionale, hitzige Debatte über unser Verhältnis zur EU, anstatt dass man die Fakten nüchtern analysiert.
Die wären?
Von den zehn wichtigsten Handelspartnern der Schweiz sind sieben Länder Mitglieder der Europäischen Union. Wir sind Teil dieses Kultur- und Wirtschaftsraums, und wir sollten demzufolge mit unserem wichtigsten Partner ein normales und sachliches Verhältnis pflegen. Ebenso müssen wir uns möglichst barrierefreie Zutritte in andere Märkte, allen voran in die USA, aushandeln. Notabene war es auch hier die Agrarlobby, die uns Mitte des letzten Jahrzehnts den privilegierten Marktzugang zu den USA verunmöglichte. Wir müssen auch nach Asien und Afrika schauen, welche aufstrebenden Länder attraktive Wirtschaftspartner sind. Von diesen aufstrebenden Märkten sollen auch unsere Unternehmen profitieren. Da muss die Politik visionärer Türöffner sein.
Hat die Schweiz denn keine aussen- und wirtschaftspolitische Vision?
Eine mutige Vorwärtsstrategie fehlt.
Da würde das EDA das Gegenteil sagen?
Die Schweiz muss ohne ideologische Scheuklappen eine faktenorientierte und Standortinteressen-orientierte Aussenwirtschaftsstrategie für die nächsten zehn, fünfzehn Jahre entwickeln. Das heisst auch eine völlig nüchterne Analyse unseres Verhältnisses gegenüber Europa. Die Schweiz ist für die EU relativ wichtig. Aber die EU ist für die Schweiz wirtschaftlich von enormer Bedeutung. Die europäischen Staaten sind und bleiben unsere wichtigsten Handelspartner.
Sie sagen ideologiefrei. Das geht doch gar nicht?
Doch, und wir müssen eine solche Diskussionskultur wieder aufleben lassen, die auf Fakten und Wissen basiert. Die ergiebigsten Diskussionen über unser Verhältnis zu Europa hatten wir ja in den Wochen und Monaten nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative im Februar 2014. Man realisierte, wie vernetzt die Schweiz mit Europa ist, und dass es sehr, sehr schwierig werden würde, einen Sonderzug zu fahren und einseitige Lösungen durchzubringen.
Fakten scheinen Ihre Losung zu sein.
Wir müssen aufzeigen, was es braucht, damit wir den Wohlstand erstens nicht gefährden, zweitens erhalten und drittens mittelfristig erhöhen können. Das sollte die Aufgabe aller Organisationen sein, die mit der Wirtschaft verbunden sind, allen voran von einem Think Tank wie Avenir Suisse.
Hat Avenir Suisse in dieser politisch aufgeheizten Stimmung überhaupt eine Chance, sich Gehör zu verschaffen.
Das haben wir, wenn wir mit unseren liberalen Werten, langfristigen Strategien und konkreten Reformvorschlägen argumentieren, die die bestmöglichen Rahmenbedingungen für das Unternehmertum schaffen und damit Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen. Dazu müssen wir auch Probleme und Herausforderungen konkret ansprechen und nicht tabuisieren wie etwa die Demographie …
… also die Überalterung der Gesellschaft.
Genau – wir benötigen neben der dringend notwendigen Schuldenbremse in der Altersvorsorge eine Flexibilisierung und damit eine grundsätzliche Aufhebung des fixen Rentenalters. Wir benötigen ebenso eine liberale Finanz- und Budgetstrategie. Wir müssen uns doch überlegen, in welchen Bereichen die Staatstätigkeit nach wie vor sinnvoll ist und welche tradierten Staatsleistungen nicht mehr notwendig sind. Es gibt Leistungen, die besser vom Privatsektor erbracht werden können, damit Steuergelder verstärkt in Zukunftsinvestitionen gelenkt werden.
Da ist der Aufschrei, den Avenir Suisse verursacht, schon programmiert.
Wenn der Aufschrei dazu führt, dass über die Zukunft der Schweiz und ihre Erfolgsfaktoren verstärkt nachgedacht und diskutiert wird, ist dies doch nicht schlecht. Wir brauchen nicht nur einen Wettbewerb der Systeme und zwischen den Kantonen, wir brauchen einen Wettbewerb der Ideen. Wer, wenn nicht ein Think Tank wie Avenir Suisse, sollte einen Beitrag zur Debatte leisten?
Sind Provokation und Tabubrüche Ihre Methode?
Provokationen müssen immer konstruktiv erfolgen – sonst laufen sie ins Leere. Wir legen dar, welches die wichtigsten Wachstums- und damit Prosperitätsgeneratoren der Schweiz sind und überlegen uns, wie diese in den nächsten zehn und fünfzehn Jahren weiterentwickelt werden müssen.
Ist das Ihr Programm?
Wir müssen die Schweiz zehn Jahre vorausdenken und nicht in Drei-Monats-Sprüngen von Abstimmungsdatum zu Abstimmungsdatum argumentieren. Man darf nicht stehen bleiben, sondern muss sich permanent verändern. Wir dürfen nicht auf die nächste Volksinitiative mit populistischem Charakter warten, die es nur auf kurzfristige Wahlgewinne anstatt auf eine prosperierende Zukunft der Schweiz abgesehen hat.
Sie plädieren für eine autonome, selbstbestimmende Schweiz. Nun leben wir in einer globalisierten Welt, die sich zunehmend vernetzt. Kann die Schweiz überhaupt noch selbstständig handeln und regulieren?
Die Globalisierung ist eine Tatsache und fördert das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand. Diese bekämpfen zu wollen, wäre ökonomischer und politischer Unsinn. Auch supranationale Standards sind wichtig. Angesichts der weltweit vernetzten Wirtschafts- und Handelsbeziehungen profitieren die einzelnen Länder so von Rechts- und Investitionssicherheit, aber auch die Unternehmen, die in- und ausserhalb der Schweiz tätig sind. Deshalb sollten wir ein Interesse daran haben, an diesen Regeln mitzuarbeiten und mitzuwirken. Wenn unser Land nun aber lieber die formelle Souveränität pflegt, verlieren wir, weil wir nur noch supranationales Recht nachvollziehen können. Deshalb wäre es intelligenter, wir würden von Anfang an mitarbeiten, mitdenken und hätten dadurch eine gewisse Vorbildfunktion. Das würde die Attraktivität der Schweiz erhöhen.
Diese Öffnung setzt aber einen mentalen und politischen Wandel in der Schweiz voraus. Wie soll das geschehen?
Das setzt einen Lernprozess von uns allen voraus. Natürlich machen die globalen, gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen gewissen Bevölkerungskreisen Angst. Niemand weiss genau, wohin die Reise führt und was noch alles auf uns zukommt. Wir müssen diese Entwicklungen aber von der anderen Seite her sehen: Sie bringen unglaubliche Chancen. Wenn wir über den wirksamen Abbau der gigantischen jährlichen Verkehrsbehinderungen von über 21’000 Staustunden nachdenken, sollten wir die Debatte nicht nur auf sechsspurige Autobahnen alleine fokussieren, debattieren sollten wir auch über Mobility-Pricing und über Investitionen in neue Technologien wie beispielsweise selbstfahrende Autos. Wir hätten die allerbesten Voraussetzungen, eines der führenden Länder in den Bereichen Robotik oder Industrie 4.0 zu werden, wenn wir traditionelle Denkmuster aufbrächen und selbstbewusst in die Zukunft blickten.
Welches ist die Rolle von Avenir Suisse in diesem Prozess?
Aufzeigen, dass es möglich ist.
Vordenker und Visionäre haben es in der Schweiz immer schwer. Zudem ist die Tradition der Think Tanks hierzulande noch nicht sehr verankert.
Avenir Suisse macht keine Tagespolitik. Wir entwickeln Ideen und Modelle für die nächsten Jahre und Jahrzehnte und werden aufzeigen, dass weitreichende Modernisierungen unabdingbar sind. Und wenn anfänglich viele dagegen opponieren werden, wird dies für uns nur Ansporn sein, unsere Argumente noch besser abzustützen. Wir wollen Denkblockaden aufbrechen, und zwar mit einer sauberen, ökonomischen und faktenbasierten Argumentation.
Dieses Interview von Pascal Ihle und Andreas Hugi ist im Newsletter «influence» der Kommunikationsagentur Furrerhugi erschienen. Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.