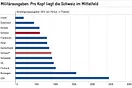Eine gute Einführung in die Steuerlehre beginnt in der Regel mit dem Hinweis darauf, dass nur Menschen in der Lage sind, Steuern zu zahlen. Während das bei der Hundesteuer noch einleuchtend ist, geht es bei anderen Steuern rasch vergessen. Paradebeispiel ist die Unternehmensbesteuerung. Da ein Unternehmen nichts anderes als eine Rechtshülle darstellt, kann es auch keine Steuerlast tragen.
Die Steuern werden indirekt durch Aktionäre (niedrigere Dividende), Angestellte (niedrigere Löhne), Kunden (höhere Preise) usw. gezahlt Man spricht von der Steuerinzidenz, um zu beschreiben, welche Anspruchsgruppe welchen Teil einer Steuer zu entrichten hat. Die Forschung dazu umfasst Tausende von Studien. Besonders bei der Gewinnbesteuerung von Unternehmen ist die Frage der Inzidenz ein Politikum.
Löhne unter Druck
So geht man im linken Teil des politischen Spektrums davon aus, dass die Aktionäre die Unternehmenssteuern zu begleichen haben und darum eine gewünschte Umverteilung «vom Kapitalisten zum Arbeiter» entsteht. Die empirische Forschung stützt diese Sicht nicht. Sie zeigt, dass durch steigende Gewinnsteuern in erster Linie die Löhne der Angestellten unter Druck geraten.
Klarer sieht das Ergebnis bei den Lohnnebenkosten aus. In der Schweiz bestehen sie aus Sozialabgaben für AHV, IV, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung usw. Gemäss Gesetz werden die meisten Lohnnebenkosten je hälftig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen. Allerdings ist die gesetzliche Aufteilung aus ökonomischer Sicht weitgehend irrelevant, die effektive Traglast entspricht nicht der gesetzlichen Zahllast.
Faktisch liegt die Inzidenz der Lohnnebenkosten zum Grossteil bei den Arbeitnehmern. Dass dies nicht nur graue ökonomische Theorie ist, wissen alle, die einmal eine Haushalthilfe beschäftigt haben. Für das eigene Budget spielen nur die totalen Lohnkosten eine Rolle.
Welcher Anteil des an die Sozialversicherungen zu überweisenden Betrags offiziell von welcher Partei getragen wird, interessiert dagegen kaum. Für einen Arbeitgeber sind bei Einstellung und Lohnverhandlungen ausschliesslich die totalen Lohnkosten relevant, egal was auf der monatlichen Abrechnung zuhanden des Angestellten aufgeführt ist. Genauso interessiert sich der Arbeitnehmer primär für das tatsächlich ausbezahlte Gehalt.
Spielt die Aufteilung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen also keine Rolle? Doch! Menschen agieren nicht stets rational, wie es das Modell des Homo oeconomicus annimmt. Das hat der Wirtschaftsnobelpreisträger Richard Thaler in seiner Arbeit immer wieder gezeigt. Menschen tendieren dazu, nicht direkt aus der eigenen Tasche zu bezahlende Kosten zu vernachlässigen.
Da die monatliche Lohnabrechnung nur die Beiträge an die Sozialversicherungen ausweist, die gemäss Gesetzesbuchstabe den Arbeitnehmenden angerechnet werden, unterschätzt dieser in der Regel die tatsächliche Lohnaufwendung seines Arbeitgebers, wie auch den effektiven Beitrag an die Kosten der Sozialversicherungssysteme. Während ersteres vielleicht bei Lohnverhandlungen zu Konflikten führt, hat letzteres handfeste politökonomische Konsequenzen.
Reformbremse
Diese Kostenunterschätzung kann sich verzerrend auf die politischen Präferenzen in Abstimmungen auswirken und so etwa sozialpolitische Reformen erschweren, da man sich des vollen Umfangs der Ausgaben zu wenig bewusst ist.
Dem könnte relativ einfach entgegengewirkt werden, indem die «künstliche» Unterscheidung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen gestrichen würde. Auf dem Lohnausweis erschienen dann alle Abzüge in vollem Umfang und dies mit dem tatsächlichen vom Arbeitgeber aufgewendeten Bruttolohn als Basis.
Damit würde die Last der Lohnnebenkosten nicht nur derjenigen Person zugewiesen, die sie zu tragen hat. Es würde auch nicht verwundern, wenn diese Massnahme und das damit steigende Kostenbewusstsein den sozialpolitischen Reformwillen mehr zu entfachen vermag als jede politische Kampagne.
Dieser Beitrag ist am 6. Juni 2018 in der «Finanz und Wirtschaft» erschienen.