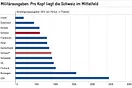Die Corona-Pandemie hat uns nicht nur überrascht, sondern sie brachte auch eine unangenehme Tatsache zum Vorschein: Punkto Digitalisierung ist die Schweizer Verwaltung eine Spätzünderin.
Im Gegensatz zu vielen Unternehmen und anderen privaten Organisationen, die sich in der Pandemie durch eine proaktive Digitalisierung der eigenen Prozesse meist schnell an die neue Situation anpassen konnten, ist die öffentliche Hand durch wiederholte Fehlschläge aufgefallen – zuletzt mit dem Projekt für ein digitales Impfbuch, das der Stiftung «meineimpfungen» anvertraut worden war.
Wenig Dynamik in Sicht
Grundsätzlich sollte E-Government immer mit einen Paradigmenwechsel einhergehen: Es geht darum, alle Interaktionen des Staates und seiner Bürger durch die «digitale Lupe» zu betrachten und sie möglichst effizient auszugestalten. Es kann nicht genügen, amtliche Formulare online zu stellen. Insofern ist der Ansatz, den der Bund für die elektronische Signatur gewählt hat, bedenklich. Die Verwaltung hat in einem ersten Schritt 1700 Verfügungen in der Schweizer Gesetzgebung identifiziert, die derzeit eine analoge Unterschrift erfordern. Diese werden nun einzeln daraufhin geprüft, «ob im konkreten Fall Hindernisse für die Digitalisierung bestehen oder nicht […] und ob allenfalls eine Gesetzes- oder Verordnungsänderung erforderlich ist» (sic).
Dieses Beispiel ist alles andere als anekdotisch und deutet auf eine erhebliche Verzögerung bei der digitalen Transformation der Verwaltung. Eigentlich wäre es die Schweiz gewohnt, in internationalen Innovationsrankings an der Spitze zu stehen. Beim E-Government ist sie inzwischen aber das Schlusslicht in Westeuropa (Rang 16 von 16). Die digitalen Defizite sind besonders gross in den Bereichen mit Bezug zu Justiz und Gesundheit, und der Datenschutz kann nicht der einzige Grund dafür sein: Andere, nicht minder Daten-sensible Branchen wie das Bankwesen sind in Sachen Digitalisierung weit fortgeschrittener.
Am wichtigsten ist die e-ID
In der Schweiz gibt es seit 2008 eine öffentliche Organisation zur Umsetzung der E-Government-Strategie, die Bund, Kantone und Gemeinden umfasst. Dreizehn Jahre später muss man sagen, dass ihre Erfolgsbilanz nach wie vor dürftig ist – mit Ausnahme von Steuererklärungen und einigen wenigen Erfolgen, wie z.B. eUmzugCH. Sogar in Bezug auf die bestehenden Dienste besteht ein erhebliches Informationsdefizit. 2020 gab fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung an, keinen der elektronischen Dienste der Behörden zu nutzen, weil sie diese nicht kannten.
Auf der politischen Ebene mangelt es nicht an Strategien und Aktionsplänen, obwohl eigentlich alle wissen, was es braucht, um das volle Potenzial der digitalen Transformation freizusetzen: vollständig digitalisierte kommunale Dienstleistungen, elektronische Patientenakten und digitale Rezepte im Gesundheitswesen, elektronische Stimmabgabe und Unterschriftensammlung im Bereich der Bürgerrechte oder die Digitalisierung aller vom Staat verwalteten Register, wie zum Beispiel des Grundbuchs.
Im vergangenen Mai lancierte der Bundesrat ein neues Projekt zur digitalen Identität (e-ID), nachdem im ersten Anlauf der Souverän eine Abfuhr erteilte. Sollte es diesmal gelingen, könnte es eine wichtige Hebelwirkung für die digitale Transformation des Landes entfalten. Mit einer der besten Infrastrukturen der Welt und einer Bevölkerung, die im internationalen Vergleich gut ausgeprägte digitale Kompetenzen aufweist, hätte die Schweiz eigentlich alle Karten in der Hand, sich an die digitale Weltspitze anzuschliessen.
In der Sommerreihe «Corona in Zahlen» beleuchten die jüngeren Forscherinnen und Forscher von Avenir Suisse die Folgen der Pandemie für unterschiedlichste Bereiche unserer Gesellschaft: die Staatsausgaben, den Aussenhandel, Verkehrsfragen, die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen, die Gleichstellung – und vieles mehr.