Immer lauter werden die Stimmen, die den Elektrizitätsmarkt stärker regulieren wollen. Die Rede ist von Marktversagen, das uns in die aktuelle Lage gebracht habe.
Eher sollte man aber von einem Staatsversagen sprechen, denn in der Schweiz ist der Strommarkt weitgehend verstaatlicht: Von der Produktion über die Verteilung bis zum Anschlusspunkt eines Abnehmers sind staatliche Unternehmen tonangebend – oft gar als regionale Monopolisten. Das Bundesamt für Energie schätzt, dass die Stromversorgungsunternehmen zu fast 90% im Besitz der öffentlichen Hand sind. Weiter sind über 99% aller Stromkunden gefangen, d.h. sie können ihren Versorger nicht frei wählen. Kommt hinzu, dass grössere staatliche Stromversorger in den letzten Jahren massiv in Produkte und Dienstleistungen u.a. im Bereich der Elektroinstallationen investiert haben und damit auch direkt private Unternehmen konkurrenzieren.
Doppelrolle als Spieler und Schiedsrichter
Ein weiteres Problem ist, dass der Staat nicht nur Eigner ist, er bestimmt als Regulator auch die Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich «seine» Unternehmen zu bewegen haben. Die Doppelrolle als Spieler und Schiedsrichter ist potenziell zum Nachteil der wenigen privaten Akteure.
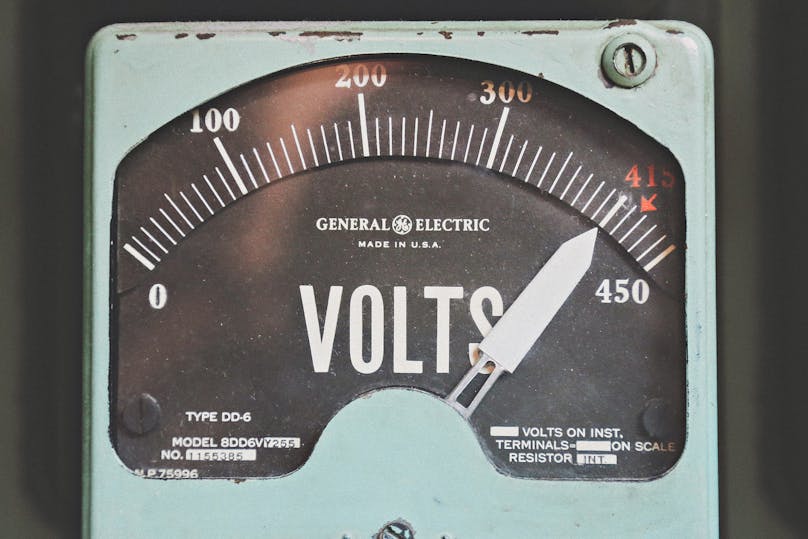
Im Strommarkt herrschen hohe Spannungen zwischen den verschiedensten, meist staatlichen Akteuren. (Thomas Kelley, Unsplash)
Auch zwischen den staatlichen Eignern – z.B. bei der Axpo – gibt es Konfliktpotenzial. So profitiert der Kanton Aargau – im Gegensatz zum anderen grossen Miteignerkanton Zürich – massgeblich von Wasserzinsen. Überhaupt stehen oftmals auch finanzielle Interessen der staatlichen Eigner im Vordergrund und nicht nur die Versorgungssicherheit – der Staat ist nicht per se ein Eigentümer, der es mit seinen Kunden gut meint. So unterliegen etwa die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) per Gesetz einem expliziten Gewinnziel. Zweistellige Millionenbeträge sind jährlich in die Staatskasse abzuliefern. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass die Gewinne eher zulasten des Portemonnaies der gefangenen und nicht der freien Kunden erwirtschaftet werden.
Die Kantone sind angesichts des Eigentums überfordert: Wurden vor rund sechs Jahren Stimmen nach einer klaren Eigentümerstrategie laut, als die Strompreise am Boden waren und die Verluste der Stromkonzerne in teils unbekannte Höhen kletterten, so hat sich in der Zwischenzeit kaum etwas getan. Die Kantonsregierungen bleiben mit ihren Eigentümerstrategien gegenüber den Steuerzahlenden weitgehend intransparent – obwohl Letztere am Ende für Pleiten, Pech und Pannen monetär geradestehen müssten. Die Erfahrungen mit der Ausfinanzierung einiger gestrauchelten Kantonalbanken sind längst verblasst. Die Bürger werden von der Politik doppelt an der Nase herumgeführt: Sie dürfen ihren Versorger nicht nur nicht frei wählen, sie müssten im Notfall für eine verfehlte Unternehmensstrategie auch noch finanziell geradestehen.
Optionen für einen Befreiungsschlag
Eine Privatisierung der Stromversorgungsunternehmen könnte viele der angesprochenen Probleme und Gefahren lösen oder zumindest mindern:
- Das «Crowding Out» privater Investoren durch die staatlichen Unternehmen wird gestoppt.
- Die Doppelrolle «Eigentümer» und «Regulator» entfällt, die Governance verbessert sich.
- Nicht mehr die Steuerzahlenden, sondern private Investoren tragen das finanzielle Risiko.
- Die Unternehmen können von der Politik nicht mehr zu fragwürdigen industrie-, regional- und verteilungspolitischen Zielen verpflichtet werden.
- Staatliche Betriebe können nicht mehr durch gut dotiere Posten zur Pflege politischer Patronage-Netzwerke missbraucht werden.
- Die Abhängigkeit von der Politik und die fehlende Disziplinierung durch den Markt begünstigen risikoreichere Strategien. Obwohl eine explizite gesetzliche Regelung fehlt, verfügen viele Versorger de facto über eine Staatsgarantie.
- Generell stellen staatliche Unternehmensbeteiligungen Klumpenrisiken dar, denn sie konzentrieren sich in der Regel auf einzelne Branchen und wenige Unternehmen.
Unsinnig ist dabei das oft gehörte Argument, wonach der Verkauf von Staatsunternehmen immer dem Muster «Privatisierung der Gewinne, Verstaatlichung der Verluste» folge. Der Wert eines Unternehmens hängt nämlich nicht von dessen Leistungen in der Vergangenheit ab, sondern von den Zukunftsaussichten. Technisch gesehen entspricht er den diskontierten zukünftigen Gewinnausschüttungen. Je besser die Gewinnperspektiven eines Unternehmens sind, umso höher fällt dessen Bewertung aus. Die aktuelle Situation böte gerade die Möglichkeit eines hohen Erlöses. Dem Einwand, allenfalls doch genau zum falschen Zeitpunkt zu verkaufen, kann zudem entgegengewirkt werden, indem beispielsweise gestaffelt über zehn Jahre jeweils 10% der Anteile pro Jahr veräussert würden.
Mit Rahmenbedingungen den Wettbewerb befeuern
Privatisierungen sind kein Selbstzweck, sondern stellen den letzten konsequenten Schritt eines Liberalisierungsprozesses dar. Bevor privatisiert wird, sind Rahmenbedingungen und geeignete Regulierungen zu schaffen, die Wettbewerb ermöglichen und befeuern. Dazu gehört erstens die vollständige Marktöffnung und – entgegen dem politischen Trend – auch die Öffnung für ausländische Investoren. Die Schweiz ist überdies eines der letzten Länder Europas mit einem monopolisierten Markt. Im Vergleich zu den Nachbarländern zählen die inländischen Rahmenbedingungen zu den wettbewerbsfeindlichsten. Staatliches Engagement in kompetitiven Märkten, die durch private Leistungserbringung gekennzeichnet sind, ist unnötig. Anstatt mehr braucht es weniger Politik. Ansonsten bleiben die kostspieligen Zielkonflikte weiterhin ungelöst.







