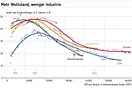Schweiz, wir haben ein Problem. Was in der Branche bereits seit einigen Jahren diskutiert wird, ist nun auch einem Grossteil der Bevölkerung bewusst: Die Gewissheit, dass der Strom weiterhin zuverlässig aus der Steckdose kommt, ist nicht mehr gegeben. So hat der Bundesrat unlängst rund 30’000 Unternehmen schriftlich aufgefordert, sich auf eine Strommangellage vorzubereiten. Das Thema Versorgungssicherheit rangiert nun hoch oben auf der politischen Agenda. Endlich, könnte man hinzufügen. Wie konnte es so weit kommen, was ist passiert im einstigen Pionierland der Wasserkraft, der ehemals zentralen Stromdrehscheibe Europas? Es ist eine Häufung zumeist hausgemachter Probleme.
Zunehmend beschränkte Importkapazitäten
Erstens brach der Bundesrat die Gespräche über ein institutionelles Rahmenabkommen ab, eine valable Alternative blieb die Landesregierung schuldig. Bereits früh machte die EU klar, dass es ohne institutionellen Überbau der bilateralen Verträge auch kein Stromabkommen gibt. Dies wäre aber notwendig, um zwei Probleme zu lösen:
Kurzfristig gilt es, die ungeplanten Stromflüsse durch die Schweiz zu vermindern. Handeln beispielsweise Deutschland und Frankreich Strom, fliesst ein Teil davon durch die Schweiz. Denn der physikalische Weg des Stroms hält sich nicht an den im Handel vereinbarten (direkten) Weg. Diese unerwarteten Stromflüsse machen jeweils sofortige Eingriffe des Übertragungsnetzbetreibers Swissgrid notwendig. Ohne diese wäre das Netz in der Schweiz nicht mehr stabil, Blackouts wären die Folge. Ob es auch in Zukunft gelingt, die Netzstabilität jederzeit aufrechtzuerhalten, ist offen, die Anforderungen steigen kontinuierlich.
Mittelfristig – bis Ende 2025 – wird die Schweiz aus Sicht der EU definitiv zum Drittstaat. Bis dann müssen unsere Nachbarländer den grössten Teil ihrer Grenzkapazitäten für den Stromaustausch mit anderen EU-Ländern reservieren. Unsere Importkapazitäten werden damit beschränkt, das Risiko einer Strommangellage steigt, die Versorgungssicherheit leidet.
Ideologischer Grabenkampf um den «richtigen» Energieträger
Zweitens ist die Schweizer Energiepolitik seit längerem in einem ideologischen Grabenkampf versunken, der bislang eine lösungsorientierte Planung und Bereitstellung der notwendigen Produktionskapazitäten verhindert. Mittendrin: die links-grüne Ideologie. Ihre Wurzeln in der Anti-Kernkraftbewegung und im Naturschutz stehen teilweise konträr zu den aus der Energiewende erwachsenden Anforderungen. Es gibt zwei Fronten: Die erste verläuft entlang der Linie «Primat Naturschutz» versus «Primat Kapazitätsausbau». Hier ist eine Straffung der Bewilligungsverfahren neuer Projekte notwendig, falls sie der Versorgungssicherheit dienen. Die Einsprachemöglichkeiten sind zu begrenzen. Bei der zweiten Front geht es um die Frage der «richtigen» Technologie für die Energiewende: Photovoltaik gegen Kernkraft.
Der politische Streit tobt, die Solarlobby ging in den letzten Wochen mit einer konzertierten Aktion in die PR-Offensive: Photovoltaik soll zur dominierenden Art der Stromerzeugung in der Schweiz werden, Panels zwingend auf allen Neubauten installiert werden, Autobahnen mit Solaranlagen überdacht werden – die Ideen schiessen ins Kraut. Technisch wohl umsetzbar, nur die Frage nach dem Preisetikett bleibt offen. Denn mit dem forcierten Aufstellen neuer Solarpanels ist es nicht getan – es gibt volkswirtschaftliche Folgekosten: Grossindustrielle Speicherlösungen müssen zugebaut werden, da bei Dunkelflaute niemand im Kerzenschein einer unbeheizten Wohnung sitzen möchte. Und das Verteil- und Übertragungsnetz muss angepasst werden, um die neuen Produktionsspitzen über Mittag effizient nutzen zu können. Dies wird Milliarden kosten.
Verletzung der Technologieneutralität
Es gibt Berechnungen, die deshalb die Kernenergie gegenüber der Photovoltaik im Kostenvorteil sehen. Politisch gehören sie aber nicht zum Mainstream. Dort wird konstant beschworen, dass nichts so günstig sei wie die Solarenergie: Die Sonne schickt keine Rechnung, der Uranlieferant aber schon. Mantraartig wird auf Neubauprojekte in Finnland, Grossbritannien oder Frankreich verwiesen. Dass zeitgleich ausserhalb Europas viele Reaktoren kostengünstiger und im Zeitplan erstellt werden, wird ignoriert. Falls Photovoltaik tatsächlich so viel günstiger ist: Wieso fordern Vertreter der Solarlobby dann einen immer noch weiter steigenden Ausbau der Subventionen? Den Abstimmenden wurde beim Energiegesetz 2017 anderes versprochen.
Nicht nur Solaranlagen werden günstiger, auch in der Kernkraft schreitet die Forschung voran. Neue Typen versprechen kostengünstiger und noch sicherer zu werden. Es mag richtig sein, dass in der Schweiz die Zeit nicht reicht, die bestehenden KKW nahtlos mit neuen zu ersetzen. Ebenfalls mag es richtig sein, dass sich zurzeit keine Investoren finden liessen, die in der Schweiz ein KKW finanzieren würden. Falsch ist es trotzdem, neue KKW zu verbieten. Das Gebot einer technologieneutralen Regulierung wird damit verletzt. Bürgerliche Politiker, die eine entsprechende Korrektur fordern, liegen deshalb im Grundsatz richtig. Ob sie damit Wählerstimmen holen, ist eine andere Frage.
Fehlende attraktivere Rahmenbedingungen für Investoren
Drittens ist das Abschneiden von alten Zöpfen zu nennen. Investitionen in die Wasserkraft sind – im Gegensatz zum politisch geforderten Ausbau – wirtschaftlich offenbar wenig attraktiv. Grosser Anteil daran hat der seit über hundert Jahren erhobene Wasserzins. Er ist der grösste Kostenblock und macht bis zu einem Drittel der Produktionsausgaben aus. Doch statt einer grundlegenden Reform, um die Wasserkraft kompetitiver zu machen, wurde die rechtliche Grundlage auf Druck der Bergkantone nicht nur verlängert, sondern der Abgabesatz wurde auch stetig erhöht. Inzwischen fliessen jährlich rund 550 Mio. Fr. an Wasserzinsen an die Standortkantone und -gemeinden. Unabhängig davon, ob effektiv Strom produziert wird und zu welchem Preis dieser auf dem Markt verkauft werden kann. Damit wird die Energie- durch die Regionalpolitik abgelöst. Denn selbstredend sorgte die sogenannte «Alpen-OPEC» auch dafür, dass die Einnahmen bei Festlegung des nationalen Finanzausgleichs nicht berücksichtigt werden – man rechnet sich also künstlich arm, um mehr aus dem nationalen Finanzausgleich zu erhalten. – Energiewende? Zweitranging, wenn es darum geht, Geld für die eigene Region abzuholen. Damit nicht genug: Um der Wasserkraft weitere Steine in den Weg zu legen, hat man politisch beschlossen, die Vorschriften über die Restwassermengen zu verschärfen. Dies vermindert die Menge des turbinierbaren Wassers – der Wasserzins bleibt aber gleich hoch.
Die Schweiz hat es selbst in der Hand
Die Schweiz braucht weniger einen «Strom-General», wie jüngst medienwirksam gefordert, sondern vielmehr eine wirkungsvolle Energiepolitik. Dazu gehört auch die Klärung des «energiepoltischen» Verhältnisses zur EU. Die Vorstellung, die Schweiz sei bezüglich Elektrizität eine Insel, ist realitätsfern. Die Vorteile einer Zusammenarbeit sind evident. Beim Streit Solar- versus Kernkraft ist weniger Ideologie und mehr politische Zusammenarbeit zugunsten technologieneutraler und attraktiver Rahmenbedingungen für die Energieproduktion gefragt. Dazu gehören grundlegende Reformen im Energiemarkt wie die Abschaffung des Wasserzinses in seiner heutigen Form. Würden parallel dazu der Strommarkt vollständig geöffnet und die staatlich dominierten Stromkonzerne in die Unabhängigkeit entlassen, könnte dies auch marktseitig die nötige Dynamik und den Innovationsdruck schaffen, um die Versorgungssicherheit der Schweiz langfristig zu sichern.