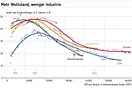Im globalen Massstab ist die Schweiz ein kleines, wirtschaftlich sehr erfolgreiches Land. Diese Prosperität verdankt sie auch einem – gemessen an der Kleinheit des Landes – aussergewöhnlichen Wissens- und Forschungsplatz. Einige unserer Hochschulen erbringen hervorragende Leistungen, die weltweit ausstrahlen. Der Werkplatz und die exportierende Industrie, aber auch der Finanzplatz und die Dienstleistungswirtschaft sind auf die Befruchtung durch den Wissensplatz und seine Ideen angewiesen.
Die kritische Masse der Mittel steigt
Doch künftiger Erfolg ist nicht garantiert. Der globale Wettbewerb verschärft sich mit zunehmender Mobilität der begehrten Talente. Auf vielen Gebieten wird Spitzenforschung anspruchsvoller und aufwendiger, die kritische Masse der Mittel steigt. Gleichzeitig steht der Bildungs- und Forschungsfranken in Konkurrenz mit anderen Staatsaufgaben. Will die Schweiz ihre Position halten oder ausbauen, muss sie ihre Kräfte auf dem Wissensplatz stärker bündeln als bisher.
Der Kontrast zur Wirklichkeit der Schweizer Hochschulpolitik ist gross. Hier stehen nicht Effizienz oder Exzellenz im Zentrum, sondern allzu oft ein Geflecht regionalpolitischer Anliegen. Statt sich zu fragen, ob die Schweiz wirklich sieben Phil-I-Fakultäten braucht oder eine weitere Wirtschaftsfakultät, setzt man die Energien dafür ein, einen möglichst grossen Teil des öffentlichen Kuchens für die Bildung abzuschneiden und dann «freundeidgenössisch» zu verteilen. Hochschulen werden als eine Art Service public verstanden, die überall im Land ein möglichst komplettes Angebot gewährleisten sollen. Das Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz ist Ausdruck dieser föderal-korporatistischen Grundhaltung, die Verteilung über Effizienz stellt.
Befreiung von politischer Einflussnahme
Die Schweiz sollte sich aber als ein einziger nationaler Hochschulraum verstehen, der im globalen Konzert der Wissensplätze mitspielt. Gefragt ist kein bürokratischer Masterplan, der den Hochschulen Rollen zuweist, sondern mehr Gestaltungsfreiheit für die einzelnen Institutionen. Dazu müssten sie möglichst aus der politischen Einflussnahme befreit werden. Ein möglicher Weg, die Debatte zu entpolitisieren, wäre der Übergang von der heutigen Anbieter- zur Nutzerfinanzierung: beispielsweise über ein staatlich finanziertes Bildungskonto, aus dem Studierende ihr Studium bezahlen. Im so entstehenden Wettbewerb müssten sich die Hochschulen überlegen, welche Studiengänge sie selbst anbieten und wo sie Kooperationen eingehen wollen. Es käme zu einer Spezialisierung und damit zur nötigen Konzentration der Kräfte. Vielleicht gäbe es weiterhin Volluniversitäten, denn die Breite der Disziplinen hat durchaus einen Wert. Wenn nicht, wäre das für die Studierenden kein Unglück, denn in der Schweiz liegen die Universitätsstädte in Pendlerdistanz.
Dieser Beitrag ist im Forschungsmagazin «Horizonte» des Schweizerischen Nationalfonds vom September 2016 (Ausgabe 110) erschienen, zusammen mit einem Beitrag von Astrid Epiney, Rektorin der Universität Freiburg, die die Volluniversität verteidigt. Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.