Seit einigen Tagen erhitzt eine Studie der Universität Zürich die Gemüter in der Schweiz. Die angebliche und heftig diskutierte Kernaussage: Studentinnen in frauendominierten Studiengängen hätten tiefere Karriereambitionen, da sie alten Geschlechterrollen nachhingen.
Stellen Sie sich nun vor, der Zürcher Kantonsrat nähme die Studie zum Anlass, die Zulassung von Frauen zu Studienfächern wie Psychologie oder Soziologie zu beschränken. Die Ratsmehrheit möchte damit erreichen, dass Frauen vermehrt ein Mint-Studium absolvierten und damit langfristig eher Vollzeit arbeiteten.
Ein solches Vorgehen wäre reichlich fragwürdig. Die selektive Interpretation einer einzelnen Forschungsarbeit ist kein guter Ratgeber für kluge Politik. Beruft sich die Politik auf wissenschaftliche Erkenntnisse, muss sie sich immer auch über die Grenzen im Klaren sein: Welche konkreten Antworten kann eine Studie – oder die Wissenschaft überhaupt – liefern? Welche anderen Aspekte sind zu berücksichtigen?
Einseitige Interpretation statistischer Lohndifferenzen
Das oben genannte Szenario mag überspitzt sein. Die einseitige Auslegung von Statistiken und wissenschaftlichen Arbeiten ist in der Politik allerdings Realität. So hat der Nationalrat Anfang Mai einer Motion zur Verschärfung der Gleichstellungspolitik zugestimmt. Seit 2020 sind Unternehmen verpflichtet, interne Lohnanalysen durchzuführen und darüber zu informieren. Neu sollen sie je nach Ergebnis sogar mit Bussen sanktioniert werden können.
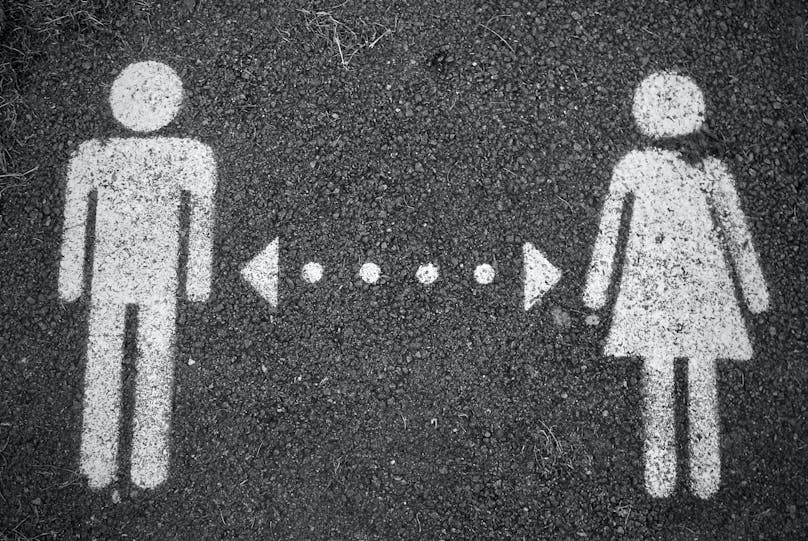
Der Befund der Lohndiskriminierung ist keinesfalls erwiesen. (Unsplash)
Begründet wird der weitreichende Eingriff mit einer angeblich verbreiteten Lohndiskriminierung von Frauen. Diese habe aller Bemühungen zum Trotz weiterhin Bestand und lasse sich nur mittels Sanktionen beseitigen. Mit anderen Worten: Weil die behördlichen Eingriffe bisher nicht gefruchtet zu haben scheinen, glaubt der Nationalrat, das Heil in noch strengeren Massnahmen zu finden (Avenir Suisse hat wiederholt vor einer solchen Regulierungsspirale gewarnt). Man muss sich fragen: Handelt die Politik hier wider besseres Wissen oder mangelt es unter der Bundeshauskuppel am generellen Verständnis der Materie?
Der Befund der Lohndiskriminierung ist nämlich keinesfalls erwiesen. Zwar erhalten Frauen bei «vergleichbaren» Eigenschaften gemäss einer gesamtwirtschaftlichen Analyse rund 8% weniger Lohn. Ob und in welchem Ausmass eine Diskriminierung tatsächlich vorliegt, lässt sich allerdings aus dieser Zahl nicht schliessen.
Dasselbe gilt für die Lohnunterschiede innerhalb eines Unternehmens: Um diese zu messen, wird in der Regel auf «Logib» zurückgegriffen – ein vom Bund zur Verfügung gestelltes statistisches Allheilmittel. Basierend auf einer Handvoll persönlicher und stellenspezifischer Merkmale wird eruiert, ob Lohndifferenzen zwischen den Geschlechtern vorliegen. Was sich nicht durch die wenigen berücksichtigten Faktoren begründen lässt, wird automatisch als Diskriminierung ausgewiesen. Das ist falsch, denn auch hinter der «unerklärten Lohndifferenz» können sich legitime lohnbestimmende Unterschiede verbergen. Zudem erkennt das Tool nicht, wenn etwa einer Frau infolge des Geschlechts eine Beförderung (und mehr Lohn) verwehrt wird. Auch die «erklärte Lohndifferenz» ist deshalb nicht vor Fehlinterpretationen gefeit. Es wäre daher unsinnig, auf Grundlage eines unvollständigen Berechnungsmodells auch noch Bussen auszusprechen.
Der fehlgeleitete Vorstoss droht sogar der Gleichstellung zu schaden. Unternehmen scheuen Sanktionen, schwarze Listen und den damit verbundenen Reputationsschaden. Sie werden das primitiv konzipierte Analysetool zu ihren Gunsten zu nutzen wissen, sollte es Lohndifferenzen zutage bringen. Noch problematischer: Weil die effektive Berufserfahrung in der Statistik nicht berücksichtigt wird, taxiert Logib die Anstellung von Frauen mit längeren Erwerbsunterbrüchen als Lohndiskriminierung. Also besser keine Frauen nach einer Mutterschaftspause (oder gleich gar keine Frauen) mehr einstellen?
Zweierlei Massstäbe
Es sind zwei Episoden in der geschlechterpolitischen Debatte, die sich inhaltlich überlagern – in ihren Mustern aber unterscheiden. Auf der einen Seite eine medial kontrovers diskutierte Studie zu Rollenbildern und Geschlechterverhalten: Es ist zu begrüssen, wenn sich Medien und Politik kritisch mit einer wissenschaftlichen Studie auseinandersetzen. Ein besseres Verständnis in der Öffentlichkeit zu Fragen der Kausalität, des Studiendesigns und der Interpretation wissenschaftlicher Ergebnisse tut not.
Auf der anderen Seite die Lohndebatte: Fortwährend wird das Narrativ der geschlechtsspezifischen Lohndiskriminierung breit bedient; basierend auf einer selektiven und geradezu eigensinnigen Interpretation der Lohnstatistiken. Nur scheint das dort kaum jemanden zu stören. Im Gegenteil: Wie der Nationalratsentscheid zeigt, verfängt das Narrativ inzwischen bis weit ins bürgerliche Lager. Oft genug wiederholt, werden auch faktenferne Behauptungen irgendwann geglaubt.






