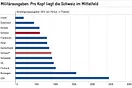Die letzte geldpolitische Amtshandlung in der Ära von Mario Draghi als Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) scheint auf den ersten Blick nicht unbedingt dramatisch: Der Einlagesatz der Geschäftsbanken wurde um 0,1 Prozentpunkte auf -0,5% gesenkt, gleichzeitig wurde ein Staffelzins für bestimmte Freibeträge eingeführt – etwas, was die Schweizerische Nationalbank (SNB) hierzulande vom Prinzip her bereits bei der Einführung der Negativzinsen festgelegt hat. Darüber hinaus wird das Anleihenkaufprogramm im monatlichen Umfang von 20 Mrd. € wieder aufgenommen.
Die EZB bleibt expansiv
Begründet werden die Massnahmen mit der sich eintrübenden Konjunktur in der Eurozone und der schleppenden Teuerung. Ob die Geldschwemme irgendeinen nachhaltigen Effekt auf die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung hat, ist freilich ungewiss. Das Vorgehen der EZB steht aber schon fast symbolhaft für den wiedererstarkten Glauben an die Feinsteuerungsmöglichkeit und -notwendigkeit der gesamten Volkswirtschaft. Davon abgesehen, dass eine solche Sicht in einem heterogenen Gebilde wie der Eurozone ohnehin paradox anmutet, wird damit der Anspruch an die Geldpolitik überstrapaziert.
Natürlich ist ihr Einfluss im Falle einer grossen Finanzkrise wie zuletzt 2008 immanent, doch die Kommastelle hinter der Wachstumsrate beeinflussen zu wollen, übersteigt ihre Möglichkeiten. Dies ist auch nicht weiter tragisch, denn Konjunkturzyklen und Rezessionen gehören zum Wirtschaftsgeschehen dazu und steigern – solange sie nicht überschiessen – langfristig wahrscheinlich gar die Wachstumsfähigkeit, indem sie die Volkswirtschaft immer wieder dazu zwingen, ihre Ressourcen zu reallozieren und effizienter einzusetzen.
Die SNB hält an ihrem Kurs fest
Der geldpolitische Entscheid der EZB ist vor allem als Zeichen dafür zu deuten, dass diese ihre Geldschleusen noch lange weit offenhalten will. Davon ist auch die SNB betroffen, ist das Vorgehen der EZB doch ein entscheidender Faktor für die hiesige Geldpolitik. Sie hat im Rahmen ihrer eigenen Lagebeurteilung zwar besonnen reagiert und die Zinsen nicht noch weiter gesenkt, trotzdem ist der politische und öffentliche Druck auf die Währungshüter in den letzten Wochen merklich gestiegen.
Einerseits steht das Negativzinsregime per se in der Kritik. Dies verwundert wenig, widerspricht es doch unserer angelernten Intuition, fürs Sparen quasi noch drauflegen zu müssen. (Allerdings sparen wir ja nicht nur, um für den Konsumverzicht entschädigt zu werden, sondern auch, um unseren Konsum über die Zeit zu glätten.) Natürlich sind die Negativzinsen für viele Wirtschaftsteilnehmer eine Herausforderung. Aber ihre Aufhebung wäre ohne äusserst schmerzhaften Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken kaum zu haben, auch wenn teils fast schon nonchalant das Gegenteil behauptet wird.
Andererseits wecken die enorm hohen Devisenreserven der SNB oder die Erträge aus den Negativzinsen immer wieder Begehrlichkeiten in der Politik. So steht aktuell zur Debatte, die AHV mit dem Gewinn aus dem Geschäft mit den Negativzinsen zu beglücken. Ein bisschen Venezuela für die Schweiz sozusagen, hatte man die direkte Finanzierung von Sozialwerken durch die Nationalbank in entwickelten Ländern doch einst mit gutem Grund überwunden.
Den meisten Vorschlägen der Kritiker gemein ist, dass sie die Position der SNB zu untergraben drohen. Stärke, Rückhalt und Unabhängigkeit einer Institution zeigen sich jedoch erst recht in schwierigen Zeiten. Geldpolitik und Entscheidungen der Zentralbank sollen selbstredend diskutiert werden können. Wer jedoch politisch Einfluss auf die SNB zu nehmen versucht, setzt nicht nur deren Reputation, sondern auch die makroökonomische Stabilität der Schweiz aufs Spiel.